Hans-Walter Leonhard
Pädagogik studieren
Internet-Version des gleichnamigen Buches, das 1992 im Verlag W.
Kohlhammer [Stuttgart, Berlin, Köln] erschien.
Das Buch als PDF-Datei
© Leonhard 2014
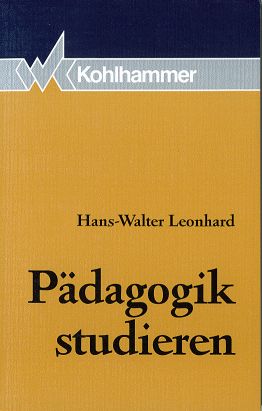
Hans-Walter LeonhardPädagogik studierenInternet-Version des gleichnamigen Buches, das 1992 im Verlag W.
Kohlhammer [Stuttgart, Berlin, Köln] erschien.
|
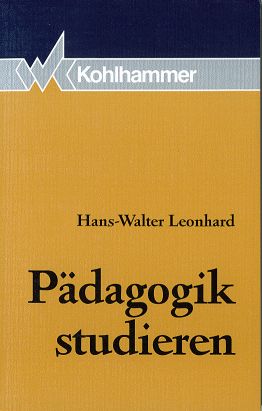 |
Inhalt
Anhang (pdf-Datei):
Logische Grundformen wissenschaftlicher Argumentation
Die Universität ist eine wissenschaftliche Hochschule. Für das Studium der Pädagogik(1) an der Universität bedeutet dies: Es ist ein Studium der pädagogischen Wissenschaft - und es ist ein wissenschaftliches Studium der Pädagogik.
Neben vielen anderen Schwierigkeiten am Beginn des Studiums bereitet dieser Anspruch der Wissenschaftlichkeit oft Probleme, die von den Lehrenden häufig zu wenig oder gar nicht berücksichtigt werden. Sie setzen die Fähigkeit zum akademischen Studium schlicht voraus und beklagen dann, daß die Studienanfänger und -anfängerinnen dazu immer weniger geeignet seien. In dieser Weise allein gelassen entdecken viele Studierende erst durch Enttäuschungen, Mißerfolge und Fehler, was das Studium an der Universität beinhaltet und welche Anforderungen gestellt werden. Hier will dieses Buch eine Hilfe bieten: Zwar werden auch einige inhaltliche Fragen der Pädagogik angesprochen, aber es versteht sich dabei nicht als eine Einführung in das Fach Pädagogik, sondern es versucht eine Vorbereitung auf das wissenschaftliche Studium der Pädagogik, eine Propädeutik. Thema sind daher vor allem die Merkmale und Aufgaben, Schwierigkeiten und Probleme, die mit dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit verbunden sind.
Diese Wissenschaftlichkeit bezieht sich zuerst auf die Inhalte des Studiums: Die akademische Pädagogik ist keine praktische Erziehungslehre; sie enthält nur selten Ratschläge, die unmittelbar auf die konkreten Fragen der Erzieher und Erzieherinnen eingehen, sondern größtenteils Texte, in denen wissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien behandelt werden (vgl. Berg 1991). Die Probleme, zu denen dies führen kann, möchte ich durch meine eigenen Erfahrungen verdeutlichen. Ich erinnere mich noch gut an eines der ersten Seminare, das ich als Student besuchte: Wenn darin der Dozent oder Studierende höheren Semesters bestimmte Aussagen und Argumente als wissenschaftlich bezeichneten oder andere als unwissenschaftlich kritisierten, wagte ich kaum noch, Fragen zu stellen oder mich an Diskussionen zu beteiligen. Zwar glaubte ich durchaus, einen kritischen Verstand zu besitzen und denken zu können, aber ich wußte nicht, wie man wissenschaftlich argumentiert. Auch als ich einmal meinen ganzen Mut zusammennahm und fragte, was denn Wissenschaft eigentlich sei, halfen mir die Antworten nicht weiter: Einerseits wurden sofort Begriffe eingeführt, die mir unbekannt waren, andererseits entspann sich eine kontroverse Diskussion zwischen den 'Experten', bei der ich zum Teil nicht einmal die Probleme erfaßte, über die sie sich stritten. Daraufhin befürchtete ich eher noch mehr, unter dem an der Universität erforderlichen Niveau zu bleiben und mich zu blamieren, wenn ich etwas sagen oder fragen wollte. - Wahrscheinlich ergeht es auch heute noch vielen Studienanfängern und -anfängerinnen ähnlich, auch bei ihnen löst die Forderung nach Wissenchaftlichkeit Unsicherheit oder gar Angst aus, weil sie nicht wissen, was damit eigentlich gemeint ist.
Das erste Kapitel versucht deshalb ganz allgemein zu klären, was der Ausgangspunkt und der Zweck von Wissenschaft ist, welche grundsätzlichen Formen von Erklärungen es gibt und welchen Ansprüchen wissenschaftliche Aussagen genügen müssen; in einem Exkurs wird erläutert, wie ein Entwurf fruchtbarer Erklärungen entsteht. Da wissenschaftliche Aussagen sich der Überprüfung und kritischen Beurteilung stellen müssen, gibt das zweite Kapitel einen Überblick, nach welchen Gesichtspunkten eine derartige Beurteilung vorgenommen werden kann. In einem Anhang werden außerdem die logischen Grundformen wissenchaftlicher Argumentation beschrieben. Er sollte schon während der Lektüre des Haupttextes zu Rate gezogen werden, wenn Schwierigkeiten beim Verständnis entsprechender Begriffe oder Aussagen bestehen.
Die Studierenden der Pädagogik beginnen ihr Studium in der Regel mit der Erwartung, sich dadurch auf eine spätere pädagogischen Tätigkeit vorzubereiten. Aber wenn, wie oben gesagt, die wissenschaftliche Pädagogik nur selten praktische Ratgeber enthält - welchen Nutzen hat sie dann für die Praxis? Auf dieses Problem gehen das dritte und vierte Kapitel ein und diskutieren die Fragen: In welchem Verhältnis stehen die erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisse und Theorien zur pädagogischen Praxis? Welche Bedeutung haben sie für das pädagogische Handeln? Es ist meiner Ansicht nach wichtig, daß diese Fragen schon am Beginn des Studiums geklärt werden: Die Studierenden wissen dadurch genauer, was sie vom wissenschaftlichen Studium erwarten können, und sie werden vor Enttäuschungen bewahrt, die drohen, wenn sie mit falschen Hoffnungen ihr Studium beginnen.
Die Wissenschaftlichkeit des Studiums bezieht sich aber nicht nur auf die Inhalte, sondern auch das Studieren selbst, das sich in einigen wesentlichen Punkten vom schulischen Lernen unterscheidet. Die Aufgaben und Anforderungen, die es beinhaltet, bilden das Thema des fünften Kapitels.
Noch eine letzte Bemerkung: Ich bemühte mich um eine möglichst verständliche, einfache Darstellung und verzichtete auf die differenzierte, umfassende Behandlung der angesprochenen Probleme und ihrer Lösungsversuche - dies würde am Studienbeginn wohl mehr Verwirrung stiften als Hilfe bieten. Der Text enthält also nur Orientierungen oder erste Annäherungen, und die einfache Darstellung birgt oft die Gefahr unzulässiger Vereinfachungen. Auf dieser Ebene der Propädeutik darf deshalb nicht stehengeblieben werden, im weiteren Studium muß die gründliche Erarbeitung und inhaltliche Auseinandersetzung folgen.
* * *
Alle Wissenschaft ist nur eine Verfeinerung
des Denkens des Alltags. (Einstein)
»Soweit man überhaupt davon sprechen kann, daß die Wissenschaft oder die Erkenntnis irgendwo beginnt, so gilt folgendes: Die Erkenntnis beginnt nicht mit Wahrnehmungen oder Beobachtungen oder der Sammlung von Daten, sondern sie beginnt mit Problemen« (Popper 1969, S. 104).
Ein Problem entsteht dann, wenn man bemerkt, daß das Wissen, das man zu haben glaubt, unvollständig ist und nicht ausreicht, um ein bestimmtes Phänomen genau zu beschreiben oder zu erklären. Ein Problem führt damit zur Frage, wie etwas genau beschaffen ist bzw. warum es so ist, wie es ist.
Die Existenz von solchen Problemen und Fragen führt jedoch nicht sozusagen automatisch zur Wissenschaft, sondern es muß das Interesse hinzukommen, die Probleme zu lösen bzw. Antworten auf die Fragen zu finden. Die jeweiligen Interessen können dabei höchst unterschiedlicher Natur sein, von der Befriedigung der menschlichen Neugier ohne jeden direkten Nutzen für die Praxis bis hin zur Absicht, praktische Aufgaben (besser) bewältigen zu können. Die Interessen bestimmen damit, welchen Problemen man sich zuwendet, von ihnen hängt die Wahl des Forschungsgegenstandes ab.
Das Ziel der Wissenschaft ist es, das Ausgangsproblem durch den Erwerb neuer Erkenntnisse und neuen Wissens zu lösen, Sachverhalte genau zu beschreiben und/oder zutreffende, richtige Erklärungen zu finden. Die jeweiligen Interessen dürfen dabei die Forschung selbst nicht beeinflussen, die sich in jedem Fall nach den Eigenschaften des Gegenstandes richten muß.(2) Das Ideal der Wissenschaft sind wahre, allgemeingültige Aussagen, d.h. sie hat den Anspruch, nicht subjektive Meinungen zu verkünden, sondern objektives Wissen über ihren jeweiligen Gegenstand zu formulieren.
Nun gibt es zwar einen erkenntnistheoretischen Streit über die Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Aber: Ob oder wie weit es tatsächlich erreichbar ist, braucht hier nicht diskutiert zu werden, denn wissenschaftliche Aussagen streben zumindest nach Objektivität und Wahrheit (vgl. Popper 1969, S. 116 ff) - ohne dieses Ziel wären sie keine Wissenschaft mehr, sondern Literatur. Wer den wissenschaftlichen Disput, die argumentative Auseinandersetzung über einen Sachverhalt sucht oder sich daran beteiligt, hat dieses Ziel als Ideal, als regulative Idee der Wissenschaft immer schon akzeptiert, denn sonst wäre sein Tun sinnlos.(3)
Mit diesen Argumenten soll (selbstverständlich) nicht die Möglichkeit und auch Faktizität von Täuschungen, Irrtümern, Fehlern und von subjektiven Einflüssen auf die Erkenntnis bestritten werden. Auch die Thesen, daß das, was als Außenwelt im subjektiven Bewußtsein erscheint und als solches Gegenstand des Denkens ist, höchst subjektiv sich konstituiert und, wenn überhaupt, wenig mit der realen Außenwelt gemein hat, oder daß subjektive Gewißheiten eher auf konventionelle (Denk)Gewohnheiten zurückzuführen sind als auf tatsächliche Erkenntnisleistungen usw., mögen zutreffen und mahnen damit zur Vorsicht, zur Bescheidenheit, zur reflexiven Überprüfung scheinbarer Gewißheiten - aber sie berühren nicht die regulative Idee der Wissenschaft, die Wahrheit ihrer Aussagen.
Die wesentlichen Aufgaben der Wissenschaft sind Beobachtung, Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und das Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten, wobei es von der jeweiligen Problemstellung abhängt, welche dieser Aufgaben im Vordergrund steht.
Die wissenschaftliche Beobachtung enthält mehr als das, was die alltägliche, spontane Beobachtung an Daten liefern kann. Je nach Fragestellung umfaßt sie einen größeren Bereich, eine längere Zeitdauer usw. und benutzt in der Regel auch spezielle Methoden der Datengewinnung, von der Schulung der Beobachtungsgabe bis hin zu aufwendigen Experimenten und komplizierten Meßgeräten. Die solchermaßen erhobenen Daten sind das Rohmaterial, das dann für die Beschreibung ausgewertet werden muß. Diese Auswertung umfaßt die Einordnung nach Gemeinsamkeiten, Unterschieden, Ähnlichkeiten, Regelmäßigkeiten, zeitlichen Abfolgen usw. bis hin zur Aufstellung einer Systematik. Wissenschaftliche Beschreibungen sind also nicht einfach die schlichte (oder gedankenlose) Wiedergabe beobachtbarer Daten, sondern beinhalten oft erhebliche Erkenntnisleistungen in der Entdeckung übergeordneter Strukturen, innerer Ordnungen usw. Die Beschreibung liefert jedoch noch keine Erklärung für die beobachteten Phänomene.
In einer Erklärung wird versucht, die Frage zu beantworten, warum ein Sachverhalt oder Vorgang in der beobachteten und beschriebenen Form existiert oder aufgetreten ist. Dies erfolgt in der Regel dadurch, daß das in Frage stehende Phänomen auf bereits bekannte Tatsachen zurückgeführt oder aus ihnen abgeleitet wird.
Auf Grundlage von Beschreibungen und Erklärungen können oft Prognosen formuliert werden. Prognosen sind Folgerungen, die auf bereits gewonnenen Erkenntnissen über Regelmäßigkeiten, Ursache-Wirkungszusammenhänge usw. beruhen: Es wird angenommen, daß das, was unter bestimmten Bedingungen sich früher ereignet hat, sich auch in Zukunft ereignen wird, wenn diese Bedingungen wieder eintreten oder hergestellt werden. Je nach der Sicherheit oder dem Umfang der Erkenntnisse, auf die bei der Prognose zurückgegriffen wird, variiert die Sicherheit der Prognose; sie wird um so unsicherer, je unsicherer diese Erkenntnisse sind bzw. je weniger die vorhandenen Bedingungen oder ihre spezifische Kombination denen gleichen, die bereits erforscht wurden.
Solche Prognosen sind ihrerseits die Grundlage von Handlungsempfehlungen, in denen angegeben wird, was zu tun ist, um gewünschte Ziele zu erreichen bzw. unerwünschte Wirkungen zu vermeiden.
Erklärungen versuchen, wie eben gesagt, die Frage nach dem Warum eines beobachteten Sachverhalts oder Vorgangs zu beantworten. Eine »Warum«-Frage hat, wie Spaemann/Loew analysieren, zwei Voraussetzungen, um sinnvoll gestellt und beantwortet werden zu können:
»1. Ein Zustand der Vertrautheit mit der Welt muß vorausgesetzt werden, für welchen eine Antwort als Antwort erscheinen kann. Wenn jemand von einem fremden Stern auf die Erde käme und ihm alles, was hier geschähe, gänzlich unvertraut wäre, dann hätte die »Warum«-Frage überhaupt keinen Sinn, weil jede Antwort genauso unverständlich wäre wie das Ereignis, auf das sich die Frage bezog.
2. Dieser Zustand des Vertrautseins muß gestört sein, denn eine vollständig vertraute Welt würde ebenfalls keine »Warum«-Frage aufkommen lassen« (Spaemann/Loew 1985, S. 16).
In der Antwort auf die »Warum«-Frage, der Erklärung eines Problems, soll nun das »Vertraute mit dem Unvertrauten« (ebda S. 17) verknüpft werden. Dabei ist zwischen zwei grundsätzlichen Möglichkeiten zu unterscheiden:
a) »Die Wiederherstellung des Vertrautseins durch den Nachvollzug einer intentionalen Struktur« (ebda S. 17). Dieser Vorgang wird in der Regel 'Verstehen' genannt, es wird versucht, z.B. die Gründe oder Motive einer Handlung nachzuvollziehen, den Zweck von Vorschriften zu entdecken, allgemein: eine Bedeutung oder einen Sinn zu verstehen.
b) »Die Wiederherstellung des Vertrautseins durch die Angabe einer Gesetzmäßigkeit« (ebda S. 19). Hier wird versucht, ein einzelnes Ereignis als den besonderen Fall eines allgemeinen Gesetzes zu fassen, es als (notwendige) Wirkung von Ursachen zu bestimmen.(4)
Beispiel: In einem Topf auf dem Herd beginnt Wasser zu sprudeln. Warum? Antwort a: Das Wasser sprudelt, weil jemand den Topf mit Wasser auf die Herdplatte gestellt, sie eingeschaltet und gewartet hat, bis es kochend heiß ist, um sich damit einen Tee zuzubereiten. Antwort b: Das Wasser sprudelt, weil Wasser bei Zufuhr entsprechender Energie vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht.
In der ersten Antwort wird die Frage durch ein nachvollziehbares Motiv beantwortet, in der zweiten durch die Ableitung aus einem naturwissenschaftlichen Gesetz über die Veränderung des Aggregatzustandes von Wasser. Es handelt sich bei diesen beiden Erklärungsarten also einerseits um die Angabe einer 'Zweckursache' (Verstehen), andererseits um die Angabe einer 'Wirkursache' (Erklären im engeren Sinne). Diese Unterscheidung traf schon Aristoteles, die lateinischen Ausdrücke dafür sind 'causa finalis' und 'causa efficiens'. Nach diesen Erklärungsarten werden traditionellerweise auch die Wissenschaften unterschieden in die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften:
Die Naturwissenschaften (mit dem Vorbild der klassischen Physik) erklären durch die Angabe von 'Wirkursachen' und sind entsprechend 'Gesetzeswissenschaften' (nomothetische Wissenschaften); die zentrale Methode der Gewinnung von Daten, die den Schluß auf Gesetze erlauben, ist das naturwissenschaftliche Experiment. Die Geisteswissenschaften gelten als 'Verstehenswissenschaften' (hermeneutische Wissenschaften), da sie versuchen, einen Sinn deutend nachzuvollziehen.(5)
Beide Arten der Erklärungen setzen also ein bereits vorhandenes Wissen voraus. Rein logisch betrachtet kann man nun auch dieses vorausgesetzte Wissen anzweifeln, die »Warum«-Frage stellen und Begründungen einfordern, so daß eine Kette von Folgefragen entsteht: Diese Kette endet im Prinzip nie, denn es gibt keinen unhinterfragbaren Anfangspunkt der Erkenntnis, keine absolute Begründung (vgl. Albert 1969). Faktisch jedoch sind immer Ausgangspunkte der Argumentation und Voraussetzungen vorhanden, die nicht ihrerseits in Frage gestellt werden - denn sonst wäre noch nie ein Beweis abgeschlossen oder ein wissenschaftliches Buch geschrieben worden. Der jeweilige Ausgangspunkt wird oft durch explizite Festsetzungen bestimmt, als eine Angelegenheit von Entscheidungen (vgl. Albert 1969 und Popper 1971). Es handelt sich dabei um Aussagen usw., derer man sich subjektiv gewiß ist und an die man keine Fragen mehr hat, wo also im Sinne von Spaemann/Loew (s.o.) ein 'Zustand der Vertrautheit' besteht.
Bei den Adressaten, an die sich eine Erklärung richtet, muß dieses vorausgesetzte Wissen ebenfalls vorhanden sein, denn sonst gelingt die Verknüpfung des Vertrauten mit dem Unvertrauten nicht und sie können sie die Erklärung nicht verstehen. So banal diese Feststellung klingt, so wichtig ist sie für jede Lehre und jeden Unterricht: Der jeweils individuelle Kenntnisstand der Lernenden muß berücksichtigt werden; wer zu hoch ansetzt, leistet keine Vermittlung.
Aus dem Wahrheitsanspruch der Wissenschaft ergibt sich, wie Derbolav bei seiner Beschreibung von »Kriterien der Wissenschaftlichkeit« betont, die Forderung nach Kontrollierbarkeit der Ergebnisse:
»(1) Wissenschaft lebt vom Entwurf fruchtbarer, d.h. informationsreicher Erklärungen auf gezielte Fragestellungen, die Wahrheitsanspruch stellen und sich daher kontrollieren lassen müssen« (Derbolav 1987, S. 238).
Im Unterschied etwa zu den Erklärungen der Religion, die durch einen Glaubensakt subjektive Gültigkeit erlangen, müssen wissenschaftliche Aussagen rational nachvollziehbar und kontrollierbar sein. Dazu sind, wie Derbolav weiter ausführt, bestimmte Bedingungen erforderlich:
»(2) Diese Kontrolle hat zugleich eine formale und materiale Seite.
- Formal ist von diesen Erklärungen zu fordern, daß sie in Sätzen formuliert werden, deren Begriffe
- semantisch eindeutig, in ihren syntaktischen Verknüpfungen,
- logisch widerspruchslos sind und zugleich einen
- möglichst hohen Grad von Exaktheit aufweisen.
(3) Material muß die Kontrollierbarkeit wissenschaftlicher Erklärungen gewährleistet sein:
- durch Angabe des jeweiligen Geltungsrahmens einer Behauptung,
- durch eine entsprechende argumentative Rechtfertigung und Begründung und
- durch Vergegenwärtigung der Methode, die zu ihr geführt hat und die sich auch weiterhin zu bewähren scheint« (ebda, S. 238 f).
- Semantische Eindeutigkeit und Exaktheit: Die Begriffe müssen möglichst klar sein, und sie müssen immer mit derselben Bedeutung verwendet werden, denn sonst kann nicht genau nachvollzogen werden, was eigentlich gesagt werden soll - wodurch gleichzeitig die Möglichkeit einer Überprüfung entfällt.(6)
- Widerspruchsfreiheit: Wissenschaftliche Aussagen müssen logisch widerspruchsfrei sein, denn für Aussagen, die einander (oder den Voraussetzungen) widersprechen, kann der Wahrheitsanspruch nicht aufrechterhalten werden.
- Angabe des Geltungsrahmens: Es müssen die Bedingungen und/oder der Bereich genannt werden, unter denen bzw. für den eine Aussage zutreffen soll. Beispiele: Die Aussage »Wasser kocht bei 100« kann experimentell weder bestätigt noch widerlegt werden: Mal kocht das Wasser bei 100, mal nicht, denn die Temperatur, bei der Wasser zu kochen beginnt, hängt zusätzlich vom jeweiligen Luftdruck ab. Die Aussage »Kinder werden in Schulen nur ganz selten geschlagen« ist ebenfalls ohne Angabe des Geltungsrahmens nicht überprüfbar: Bezieht sie sich beispielsweise nur auf Deutschland oder auf alle Länder, ist das eine Aussage nur über die Gegenwart oder über den Schulbesuch von Kindern überhaupt?
- Angabe der Methode: Die Überprüfung von Forschungsergebnissen setzt voraus, daß sie wiederholbar sind; deshalb muß auch die Methode, die zu diesen Ergebnissen führte, erkennbar sein bzw. direkt angegeben werden. Wer zum Beispiel neue Befunde veröffentlicht, die aus Experimenten gewonnen wurden, muß gleichzeitig angeben, wie die Experimente durchgeführt wurden, denn sonst kann keine Überprüfung stattfinden.
- Argumentative Rechtfertigung: Zur argumentativen Rechtfertigung hier nur soviel: Sie ist das Herzstück der Wissenschaft. Während das Alltagsdenken und die Alltagsgespräche sich oft von allen möglichen Einfällen leiten lassen und Behauptungen häufig nicht genau begründet werden, muß das wissenschaftliche Denken sich am jeweiligen Problem orientieren, alle Einfälle daraufhin prüfen, ob sie zur Klärung der Sache beitragen, und alle Thesen argumentativ belegen oder beweisen. Im Nachvollzug der Argumente und Begründungen kann dann ihre Stichhaltigkeit überprüft werden.
Wissenschaftliches Denken, das diesen Kriterien(7) entspricht, kann allgemein als methodisch diszipliniertes Denken bezeichnet werden. Man kann dieses Denken nicht lernen wie man etwa eine Rechenregel lernt und nicht anwenden wie diese; gefordert ist eine immer neu zu erbringende gedankliche Konzentration. In diesem Sinne wissenschaftlich zu denken ist leicht und schwer zugleich: Es ist leicht, da nicht ein grundsätzlich anderes Denken als im Alltag gefordert ist, sondern nur gedankliche Disziplin. Es ist schwer, weil diese Disziplin eine gedankliche Konzentration erfordert, die konsequent durchzuhalten oft eine erhebliche Anstrengung bedeutet - je weniger man daran gewöhnt ist, desto mehr.
Oben wurde gesagt, daß Wissenschaft vom Entwurf fruchtbarer Erklärungen auf gezielte Fragestellungen lebe (Derbolav) und durch Erklärungen das Unvertraute mit dem Vertrauten verknüpft werde (Spaemann/Loew). Doch wie werden solche Erklärungen gefunden? Die übliche Antwort lautet: durch bewußtes logisches Denken, durch Urteilen und Schlußfolgern. Dagegen behauptet Jaynes, und ich stimme ihm zu: »Der Wissenschaftler, der sich mit seinen Problemen hinsetzt und bewußte Induktionen und Deduktionen auf sie anwendet, ist ebenso ein Fabelwesen wie das Einhorn« (Jaynes 1988, S. 59).(8) Meine These lautet deshalb: Entwürfe für fruchtbare Erklärungen entstehen unbewußt und gelangen als kreative Einfälle zu Bewußtsein.
Kreative Einfälle kann man, wie aus der Selbstbeobachtung bekannt sein dürfte, nicht willentlich erzeugen, sondern nur befördern: Ob einem etwas einfällt, das zur Lösung eines Problems beiträgt oder schon selbst die Lösung darstellt, ist keine Angelegenheit direkter willentlicher Lenkung; man kann einen Einfall nicht erzwingen, sondern er entsteht jenseits des Bewußtseins und kommt zu Bewußtsein. Ob man die richtigen Einfälle hat, ist andererseits auch nicht völliger Zufall, sondern hat in der Regel drei Voraussetzungen, die solche Einfälle befördern:
- Es muß eine gezielte Frage gestellt werden. Ein Problem zu haben (der Ausgangspunkt von Wissenschaft!) bedeutet zunächst, daß man etwas nicht weiß; man weiß damit aber auch nicht, was man tun kann, soll oder muß, um das Nichtwissen zu beseitigen. Dazu muß eine Fragestellung entwickelt, d.h. es muß positiv benannt werden, was man wissen will - erst die Fragestellung gibt die Orientierung für die weitere geistige Tätigkeit, für die Formulierung von Vermutungen, Hypothesen, Lösungsideen, die dann geprüft werden. Ohne Fragen keine Antworten - und damit auch keine Lösung von Problemen.
- Es müssen die Kenntnisse bereits vorhanden sein, aus deren Verknüpfung sich die Lösung oder ein Lösungsweg ergibt.
- Man muß sich gedanklich mit dem Problem beschäftigen, d.h. die gedankliche Konzentration auf das Problem richten und das Bewußtsein nach Möglichkeit von anderen Inhalten freihalten. In seiner Analyse des wissenschaftlichen Denkens betont Litt in diesem Zusammenhang, »daß dem Forscher nie und nimmer eine Intuition zufallen würde, in der die Lösung des ihn beschäftigenden Problems sich vorzeichnet, hätte er nicht zuvor in methodisch diszipliniertem Denken um die Lösung dieses Problems gerungen. Dem nicht durch die Schule der Methode gegangenem Kopf sind sachdienliche Einfälle versagt« (Litt 1959, S. 57).(9)
Man kann sozusagen den Boden für Einfälle bereiten, sie selbst entstehen jedoch im Unterbewußtsein, das im vorhandenen Wissen Beziehungen herstellt, Unterscheidungen trifft und einzelne Elemente neu kombiniert. Diese Vorgänge selbst bemerkt man nicht, erst ihre Ergebnisse gelangen als Einfälle ins Oberbewußtsein. Wesentliche Teile der geistigen Arbeit geschehen also jenseits der Schwelle des Bewußtseins.
Ein kleines Beispiel: Beim Nachdenken über eine Frage fällt einem ein, daß man über einen bestimmten Aspekt schon etwas gelesen hat. Nun versucht man, sich zu erinnern, in welchem Buch das war - und wenn man Glück hat, kommt die entsprechende Erinnerung. Das bedeutet: Es wurde eine Verbindung vom bewußten Gedankeninhalt zu dem im Gedächtnis gespeicherten Buchinhalt und dann zu dem Autor oder Titel hergestellt. Diese Verbindung ist als Vorgang nicht bewußt, zu Bewußtsein kommen erst die entsprechenden Ergebnisse. Im ersten Fall hat man dabei nicht einmal dem Gedächtnis sozusagen einen Auftrag gegeben, sondern das Unterbewußtsein wirkte selbsttätig: Allein die Tatsache, daß man sich bewußt gedanklich mit einem Inhalt beschäftigte, bewirkte die unterbewußte Suche, ob zu diesem Inhalt im Gedächtnis etwas Passendes gespeichert ist.
Diese unterbewußte Tätigkeit kann auch noch nach der bewußten Konzentration weitergehen, wenn man sich bereits wieder mit anderen Gedanken beschäftigt. Oft ist eine andere Beschäftigung (mit anderen Gedanken oder mit anderen Tätigkeiten) sogar förderlich oder gar notwendig, um Lösungen zu finden. Von berühmten Wissenschaftler ist bekannt, daß ihnen ihre besten Einfälle oft völlig unvermutet kamen (vgl. Jaynes 1988, S. 59 f): Helmholtz erzählt, seine besten Gedanken hätten sich besonders bei Spaziergängen im sonnigen Bergwald eingestellt, Poincaré hatte die Erleuchtung, wie ein schwieriges mathematisches Problem zu lösen sei, als er auf einer Reise gerade in einen Omnibus einstieg, und von Einstein wird berichtet, daß ihm hervorragende Ideen häufig beim Rasieren kamen (weswegen er sein Rasiermesser immer sehr vorsichtig benutzt habe, um sich in diesen Momenten nicht vor Überraschung zu schneiden).
Im alltäglichen Leben gibt es ein analoges Phänomen: Wenn einem ein bestimmter Name oder Begriff trotz größten Bemühens nicht einfällt(10), obgleich man weiß, daß man ihn kennt, ist es meist sinnvoll, die Bemühung aufzugeben und sich mit anderen Tätigkeiten zu beschäftigen - und plötzlich fällt einem der Name oder Begriff wieder ein. Offenbar befand sich das Unterbewußtsein auf einer falschen Spur, von der es solange nicht loskam, wie sich die bewußte gedankliche Konzentration auf die Frage richtete. Wahrscheinlich ist der Vorgang bei den wissenschaftlichen Problemen und Einfällen ähnlich: Das logische Denken beinhaltet, verglichen mit dem freien Denken, durch die Konzentration auf eine Frage zugleich eine Einengung auf (vermeintlich) Sachdienliches. Wenn nun innerhalb dieses Bereiches die Lösung nicht zu finden ist, muß die Konzentration wieder aufgegeben werden, damit das Unterbewußtsein die Möglichkeit hat, weitere Zusammenhänge einzubeziehen. Jaynes behauptet sogar, daß beim kreativen Denken immer diese zeitweilige Abwendung vom Problem nötig ist: »Das kreative Denken (durchläuft) verschiedene Stadien, zuerst ein Präliminarstadium, in dem das Problem bewußt durchgearbeitet wird, dann eine Inkubationsphase ohne irgendwelche bewußte Konzentration auf das Problem und darauf die Erleuchtung, die hinterher logisch begründet wird« (Jaynes 1988, S. 60).
Es ist also ein (Selbst)Mißverständnis, wenn man glaubt, die Lösung von Problemen erfolge durch bewußtes Schlußfolgern: Die eigentlichen Schlußvorgänge vollziehen sich im Unterbewußtsein.(11) Das logische Denken ist - zunächst - eine Angelegenheit des Unterbewußten; die Logik als die Lehre vom richtigen Denken wird nicht erfunden, sondern gefunden. Sie ist die bewußte Formulierung dessen, was beim Denken sich faktisch ereignet, bei welchen Verküpfungsformen von Urteilen oder Sätzen man das Gefühl hat, die Ergebnisse stimmen bzw. stimmen nicht.(12) Deshalb benötigt man auch keine explizite Kenntnis der Logik, um richtig schließen zu können.
Die Einsicht, daß wesentliche Schritte der Denktätigkeit in Vollzügen des Unterbewußtseins erfolgen, wird leicht durch die Tatsache verdeckt, daß das wissenschaftliche Denken meist in zwei Phasen erfolgt und die zweite Phase so stark im Bewußtsein hervortritt, daß die erste oft unbemerkt bleibt. Diese erste Phase ist das, was ich zu schildern versuchte: Durch das Nachdenken entstehen Einfälle, die eine (mögliche) Antwort auf die Frage darstellen, die das Bewußtsein beschäftigt hat. Diese Einfälle werden nun, und das ist die zweite Phase, bewußt formuliert, begrifflich festgehalten, was nichts anderes heißt, als daß der unterbewußt und implizit gefundene Zusammenhang oberbewußt und explizit formuliert wird.
Die Ausformulierung eines Gedankens ist dabei gleichzeitig eine erste Überprüfung, vor allem, wenn er schriftlich festgehalten wird, da dies in der Regel eine größere Festlegung bedeutet als das flüchtige Wort. Die schriftliche Darstellung der Ergebnisse von Forschungsprozessen erfolgt zudem in der Regel systematisch, d.h. als bewußt geordneter, groß angelegter Beweisgang, in dem der Beweissatz so mit den Beweisgründen verknüpft wird, daß er als notwendige Folgerung erscheint. Wenn man dabei möglicherweise Fehler entdeckt, so geschieht dies fast nie durch die bewußte Anwendung der Regeln des Syllogismus usw., sondern man wird ihrer gewahr, da durch die genaue Formulierung im Oberbewußtsein das begleitende Unterbewußtsein bemerkt, daß hier etwas nicht stimmt und dies dem Oberbewußtsein meldet.
Da diese zweite Phase, die bewußte Ausformulierung einzelner Gedanken oder eines größeren Zusammenhanges, sehr stark das Bewußtsein beherrscht, wird sie leicht für das Ganze des wissenschaftlichen Denkens gehalten und der wichtige unterbewußte Anteil übersehen. Die Lösung eines Problems, die Beantwortung von Fragen läuft aber nicht ab wie beispielsweise die Lösung einer (komplizierten) mathematischen Aufgabe: Bei der Lösung einer mathematischen Aufgabe werden Schritt für Schritt die Rechenregeln angewandt, und am Schluß des Vorgangs steht das Ergebnis, das man am Anfang noch nicht wußte und jetzt weiß, und zwar durch die Anwendung der Rechenregeln. Der Weg zum Ergebnis ist identisch mit dem Weg bei der Darstellung des Ergebnisses.
Bei der Lösung eines Problems, das nicht durch Rechnen, statistische Auswertung von empirischen Befunden usw. gelöst werden kann, steht dagegen am Anfang ein Einfall, der als mögliche Lösung erscheint. Er wird dann sozusagen rückwärts geprüft, ob er sich aus bekannten Voraussetzungen tatsächlich zwingend ergibt, ob er in Widerspruch zu anderen gesicherten Erkenntnissen steht usw., und dann, falls er sich dabei bewährt, in der schriftlichen Darstellung von diesen Voraussetzungen und gesicherten Erkenntnissen her systematisch entwickelt.
Der Weg der Darstellung unterscheidet sich also vom Weg der Erkenntnis oder Forschung, und das oben genannte (Selbst)Mißverständnis entsteht dann, wenn der Weg der Formulierung und Darstellung mit dem der Erkenntnisgewinnung identifiziert wird.
* * *
Im Unterschied etwa zu religiösen Aussagen sollen wissenschaftliche Aussagen rational einsehbar und überprüfbar sein. Dieser Unterschied hat Konsequenzen für die Form der Aneignung: Religiöse Aussagen muß man glauben, bei wissenschaftlichen Aussagen muß man kritisch fragen, ob man ihren Wahrheitsanspruch für gerechtfertigt hält oder nicht. Wer wissenschaftliche Texte nur zur Kenntnis nimmt, ohne diese Frage zu stellen und ohne sich um ein eigenes Urteil zu bemühen, studiert nicht wissenschaftlich. Das erworbene Wissen bleibt ein totes Wissen, das weder zu den bereits vorhandenen eigenen Überzeugungen in Bezug gesetzt werden noch als Handlungsorientierung dienen kann.
Wissenschaftliche Texte enthalten häufig sowohl eigene Erklärungen oder Erklärungsansätze als auch eine Kritik an anderen Erklärungen. Die folgenden Erläuterungen können und sollen dabei helfen, sich über beide Elemente wissenschaftlicher Texte ein eigenes Urteil zu bilden. Die Maßstäbe für ein solches Urteil ergeben sich aus den allgemeinen Kriterien von Wissenschaftlichkeit, wobei besonders die von Derbolav genannten Voraussetzungen für eine Kontrolle wichtig sind.(13) Genau betrachtet beinhaltet eine Beurteilung wissenschaftlicher Aussagen das Ergebnis der Kontrolle nach diesen Kriterien.
Es ist sehr peinlich, wenn einer Kritik nachgewiesen werden kann, daß Argumentationen falsch referiert, Aussagen sinnentstellend zitiert oder wesentliche Argumente übersehen wurden. Die Beurteilung eines Textes setzt also die gründliche Kenntnis voraus, und man muß sich auch bei der Absicht der Beurteilung zunächst auf den Text selbst einlassen und versuchen, ihn möglichst genau zu verstehen. Dazu ist es hilfreich, sich auch den formalen Aufbau von Texten klarzumachen und sich bei der Lektüre zu fragen, welchen Status im Gesamtzusammenhang die einzelnen Ausführungen jeweils haben.
Bei wissenschaftlichen Texten kann zwischen dem Vorwort, der Einleitung, dem Hauptteil und dem Schluß unterschieden werden. Ein Vorwort ist ein persönliches Wort vor der Sache, um die es geht; Vorworte enthalten zum Beispiel häufig Danksagungen, Hinweise auf den Anlaß oder die Motive, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Sachlich gesehen ist ein Vorwort nicht erforderlich, wohl aber eine Einleitung. Diese soll klären, um welches Thema es im Text genau geht; dazu kommen gegebenenfalls Hinweise, warum das Thema wichtig ist und wie es bearbeitet wird. Sachlich gesehen entfaltet die Einleitung vor allem die Aufgabe oder Fragestellung des Textes. Der Hauptteil bringt dann die (systematische) Lösung oder Antwort dieser Aufgabe oder Fragestellung. Je nach Art des Themas enthält er eigene Untersuchungsergebnisse, Wiedergaben anderer Texte, Stellungnahmen, Beurteilungen usw. In einem Schlußteil wird oft das Ergebnis der Arbeit nochmals zusammenfassend dargestellt, möglicherweise mit einem Ausblick auf weitere Fragen, die aus dem Ergebnis folgen. Formal gesehen ist es nicht notwendig, immer einen eigenen Schluß zu schreiben; wenn das Thema am Ende des Hauptteils sachlich abgeschlossen ist und ein Schlußteil nur langweilige Wiederholungen enthalten könnte, wird oft darauf verzichtet.
Ein Text kann nur dann genau verstanden werden, wenn er eindeutig und präzise geschrieben ist. Manchmal bereitet es jedoch große Schwierigkeiten, einen Text genau zu verstehen, weil er doppeldeutige Termini enthält, der Aufbau unklar bleibt, der Stellenwert einzelner Argumente nicht deutlich wird oder Autoren bzw. Positionen, auf die Bezug genommen wird, verkürzt dargestellt werden. Häufig suchen die Leser und Leserinnen die Schuld bei sich selbst, wenn sie einen Text nicht verstehen können. So verständlich diese selbstkritische Bescheidenheit auch ist - sie darf nicht dazu führen, daß ihnen, wie häufig bei Studierenden beobachtbar, der Gedanke gar nicht mehr in den Sinn kommt, das Unverständnis könne durch den Text selbst verursacht sein.
Der Nachweis, daß ein Text Unklarheiten, Doppeldeutigkeiten usw. enthält, ist eine erste Kritik des Textes. Sie betrifft die formale Seite der Darstellung. Eine solche Kritik sagt noch nichts über die Qualität des Inhalts aus. Wenn man bei wohlwollender Interpretation zu einer in sich stimmigen Lesart gelangen kann, sollte die Beurteilung der Darstellung nicht in Beckmesserei ausarten. Allerdings sind Mängel der Darstellung oft ein erstes Indiz, daß es auch um die inhaltliche Klarheit und die logische Stringenz des Textes nicht zum Besten bestellt ist.
Die Überprüfung von Beweisen(14) kann sich auf die Beweisgründe und das Beweisverfahren richten.
Jeder Text muß irgendwo anfangen - das klingt banal, aber ist es nicht: Es müssen Voraussetzungen eingeführt werden, auf die der Text aufbaut und die als die ersten Beweisgründe fungieren, ohne selbst im Text belegt zu werden. Das bedeutet, daß ihre eigene Gültigkeit bereits feststehen muß. Als solche Beweisgründe dienen entweder Aussagen, die unmittelbar einsichtig sind, oder Aussagen, deren Gültigkeit an anderer Stelle bereits bewiesen wurde, wobei in der Regel angegeben wird, wo der Nachweis der Gültigkeit nachzulesen ist.
Bei der Überprüfung der Beweisgründe muß man sich also fragen, ob man sie akzeptiert - wenn nein, entsteht ein schwieriges Problem, das sofort deutlich wird, wenn man sich die Anzahl der Literaturverweise in den Fuß- oder Endnoten wissenschaftlicher Texte vor Augen führt: Die Begründungen, auf die verwiesen wird, vollständig nachzulesen, ist kaum möglich, und es wäre eine Sisyphos-Arbeit, diese Begründungen selbst zu überprüfen, weil ja in diesen anderen Büchern wiederum auf weitere Literatur verwiesen wird usw. usf. Bei aller gebotenen Gründlichkeit im wissenschaftlichen Arbeiten muß deshalb pragmatisch vorgegangen werden - und alle Leser und Leserinnen gehen so vor: Einerseits werden Voraussetzungen, die plausibel erscheinen, ohne weitere Kontrolle akzeptiert, anderseits wird den Autoren und Autorinnen ein gewisser Vetrauensvorschuß dergestalt gewährt, daß sie bei der Übernahme von Voraussetzungen aus anderen Texten die dort geleisteten Begründungen geprüft haben. Nur als Stichprobe oder in Ausnahmefällen, in denen aus irgendwelchen Gründen ein Verdacht entsteht, wird man deshalb die Anfangsvoraussetzungen eines Textes selbst überprüfen.
Fast noch schwieriger wird die Überprüfung, wenn die Verfasser und Verfasserinnen eigene Untersuchungsergebnisse als Beweisgründe aufnehmen: Auch wenn dabei die Untersuchungsmethode, die Art des Experiments usw. angegeben wird, ist eine Wiederholung der Untersuchung, um das Ergebnis zu kontrollieren, für die normalen Leser und Leserinnen so gut wie nie möglich. Man muß auch hier einen Vertrauensvorschuß geben und kann nur hoffen, daß andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine Überprüfung vornehmen und gegebenfalls abweichende Ergebnisse veröffentlichen bzw. sachliche Fehler kritisieren. Solche Fehler sind meist auf unzulängliche Untersuchungsmethoden, Mängel bei der Auswahl einer repräsentativen Stichprobe usw. zurückzuführen - aber es kommt leider auch vor, daß absichtlich betrogen wird.
Wenn ein renommierter Wissenschaftler, dem selbstverständlich der o.g. Vetrauensvorschuß gewährt wird, einen solchen Betrug vornimmt, dann kann es lange dauern, bis er aufgedeckt wird; die Fälschungen von Cyril Burt (1883 - 1971) sind dafür ein trauriges Beispiel. Da dieser Fall so eklatant ist, sei er kurz beschrieben: Burt war Professor für Psychologie in London und wurde 1946 für seine wissenschaftlichen Verdienste geadelt; er verfocht sein Leben lang die These, daß die Intelligenz weitestgehend erblich bestimmt ist. Diese These begründete er vor allem mit Untersuchungsergebnissen über die Intelligenz von Zwillingen, die jahrzehntelang unüberprüft blieben, obwohl sie so unwahrscheinlich genaue Übereinstimmungen enthielten, daß der Verdacht der Fälschung sich aufdrängen mußte. Die erste öffentliche Kritik seiner Daten, die L. Kamin 1974 vortrug, wurde von Burts Anhängern entrüstet zurückgewiesen und zum Beispiel von H. J. Eysenck als politisch motivierter Angriff linksextremer Milieutheoretiker und als Rufmord diffamiert. Erst die Biographie von L. S. Hearnshaw, dem Burts Schwester Zugang auch zu den privaten Papieren, Tagebuchaufzeichnungen usw. gestattet hatte, brachte 1979 das Lügengebäude endgültig zum Einsturz (vgl. Lewontin/Rose/Kamin 1988).
Dieses Beispiel zeigt die Gefahr, die in dem Vertrauensvorschuß liegen kann, der Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen normalerweise entgegengebracht wird: Auf Grund seines hohen wissenschaftlichen Ansehens hat Burt über Jahrzehnte hin die Diskussion über die Intelligenz beeinflußt, seine gefälschten und erfundenen Daten fanden Eingang in unzählige psychologische Fachbücher.(15)
Wenn in den Beweisgründen Fehler enthalten sind, hat die darauf aufbauende Argumentation keine Beweiskraft mehr. Wenn die Beweisgründe jedoch akzeptiert werden, muß als nächster Schritt geprüft werden, ob der Beweissatz stringent aus den Beweisgründen folgt oder nicht. Während die Überprüfung der Beweisgründe, wie eben erwähnt, oft große oder unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet, ist die Überprüfung des Beweisverfahrens immer möglich. Sie sollte deshalb ein Kernstück jeder Beurteilung wissenschaftlicher Texte sein. Bei dieser Überprüfung werden die Voraussetzungen als gültig angenommen und darauf geachtet, ob die Folgerungen tatsächlich zwingend sind. Es gibt dabei kein mechanisch anwendbares Verfahren, sondern man muß dabei den Argumentationsgang selbst nach-denken und sich fragen, ob die jeweiligen Schritte schlüssig aus den Voraussetzungen folgen oder nicht.
Auch bei dieser Überprüfung ist jedoch über die tatsächliche Gültigkeit des Beweissatzes strenggenommen noch kein Urteil möglich: Es kann sein, daß er inhaltlich zutrifft, obwohl er formal gesehen unzureichend oder fehlerhaft begründet wurde. So wurden z. B. schon in der griechischen Naturphilosophie des Atomismus Vorstellungen über die Zusammensetzung der Materie aus kleinsten Teilen entwickelt, die auch aus moderner Sicht zutreffen, obwohl die damaligen Beweise naturwissenschaftlich nicht mehr akzeptiert werden können.
Allerdings ist bei einem fehlerhaften Beweis niemand verpflichtet, dem Beweissatz zu folgen: Durch die Kritik der Beweisgründe oder des Beweisverfahrens wird der Anspruch auf allgemeine Gültigkeit kritisiert - ein Text, der fehlerhafte Beweise enthält, kann deshalb nicht mehr mit dem Anspruch auftreten, daß jeder vernünftig und logisch denkende Mensch ihm zustimmen müsse. Umgekehrt darf jedoch kein Einwand gegen die Gültigkeit eines Beweissatzes aufrechterhalten werden, wenn die Beweisgründe und das Beweisverfahren akzeptiert wurden.
Auch wenn, wie gesagt, ein formal fehlerhaftes Beweisverfahren nicht notwendig zu einem ungültigen Beweissatz führt, so ist dies doch ein starkes Indiz dafür, daß der Beweissatz auch inhaltlich unzutreffend ist. In diesem Fall sollte man sich dann um die Widerlegung der fraglichen Behauptung bemühen.
Die Widerlegung eines Beweissatzes kann auf zwei Arten erfolgen: durch (a) den positiven Beweis eines entgegengesetzten Satzes oder (b) den Nachweis innerer, unaufhebbarer Widersprüche. Was sind nun die Vor- und Nachteile der beiden Arten von Widerlegung?
a) Eine Widerlegung, die auf dem positiven Nachweis eigener Aussagen beruht, hat den großen Vorteil, daß damit gleichzeitig die Sache, um die es geht, geklärt wird. Sie hat den Nachteil, daß diese Erklärung eine eigene wissenschaftliche Arbeit voraussetzt, die aus Zeit- und/oder Qualifikationsgründen oft nicht geleistet werden kann, v.a. von den Studierenden nicht.
Außerdem wird bei einer solchen Widerlegung den Vertretern und Vertreterinnen der kritisierten Theorie oft nicht klar, worin der Schwachpunkt ihrer Argumentation denn nun bestehen soll, da dies nicht explizit ausgeführt wird. Tritt dann die Situation ein, daß sie weiterhin von der eigenen Position überzeugt sind und keinen Fehler erkennen, können sie mit demselben Recht ihre Ansicht als Widerlegung der anderen Ansichten behaupten. Kommt es auf dieser Grundlage zu einen Diskussion zwischen den verschiedenen Positionen, so entsteht häufig nur ein Abtausch von Behauptungen, ohne daß in der Sache ein Fortschritt erkennbar wäre.
b) Eine Widerlegung durch den Nachweis innerer, unaufhebbarer Widersprüche hat den Vorteil, daß auch ohne eigene Forschungen und ohne eigene Erklärungen ein sicheres Urteil über die Gültigkeit eines Beweises möglich ist. Außerdem werden den Vertretern und Vertreterinnen der widerlegten Theorie Argumente benannt, auf Grund derer sie ihre Theorie nochmals überdenken, sie korrigieren oder argumentativ die Kritik zurückweisen können, wenn sie ihrerseits in der Kritik Mängel entdecken. Der große Nachteil dieser Art der Widerlegung: Sie trägt nicht zur positiven Klärung des behandelten Problems bei. Aus diesem Grund wird sie manchmal als 'nur destruktiv' zurückgewiesen, ein Einwand, der häufig auch gegen Kritik vorgetragen wird, die nur auf immanente Schwächen und Argumentationsfehler aufmerksam macht. Von den Kritisierenden wird dann gefordert, erst selbst etwas Positives zu leisten, bevor sie sich Kritik erlauben dürfen.
Nun ist es zwar für den wissenschaftlichen Fortschritt am besten, wenn neben der Kritik ein eigener positiver Beitrag geleistet wird, aber auch eine angeblich nur destruktive Kritik oder Widerlegung dient der Erkenntnis: Sie kann zeigen, daß scheinbar gesicherte Erkenntnisse noch nicht bewiesen oder gar falsch sind, sie kann der Forschung neue Aufgaben stellen oder Irrwege deutlich machen usw. Außerdem ist methodisch gesehen die inhaltliche Gültigkeit einer Kritik oder Widerlegung völlig unabhängig davon, was die Kritisierenden an eigenen Beiträgen leisten können. Im Bereich der Kunst ist dies längst anerkannt - wer einen Roman kritisiert, muß nicht selbst einen besseren Roman schreiben können. Und das gilt entsprechend im Bereich der Wissenschaft - die Ablehnung einer Kritik als nur 'negativ' oder 'destruktiv' dient oft nur als Vorwand, sich um ihren Inhalt nicht zu kümmern.
Es muß also, um nochmals kurz zusammenzufassen, bei der Beurteilung von Beweisen unterschieden werden zwischen einer Kritik, die zeigt, daß ein Beweissatz nicht bewiesen ist und einer Kritik, die ihn widerlegt: Wird in der Kritik entweder gezeigt, daß (einige) Beweisgründe nicht gesichert bzw. sachlich falsch sind, oder daß das Beweisverfahren nicht schlüssig ist, so ist der fragliche Satz kein bewiesener Satz. Wird in der Kritik hingegen gezeigt, daß der fragliche Satz nicht stimmen kann, oder wird ein kontradiktorisch entgegengesetzter Satz positiv bewiesen, so gilt er als widerlegt!
Die Auseinandersetzung mit einem wissenschaftlichen Text kann noch einen Schritt weitergeführt werden. Bislang ging es um die Frage: Genügt der Text wissenschaftlichen Ansprüchen? Gesetzt den Fall, diese Auseinandersetzung hat zu dem Urteil geführt, daß ein Text durchgängig Mängel in den Beweisgründen oder dem Beweisverfahren enthält, so kann die zusätzliche Frage gestellt werden: Gibt es einen gemeinsamen Grund für diese Mängel? Es kann ja sein, daß sie nicht einfach durch mangelnde Konzentration beim Nachdenken, durch Fehlschlüsse, die allen Menschen unterlaufen können, durch zufällige Fehler bei der Forschung usw. entstehen, sondern eine vorgängige Überzeugung vorhanden war, die wissenschaftlich begründet werden sollte. Das Denken richtet sich dann nicht mehr nach der Sache, sondern hat als Richtschnur eine vorgängige Position, gemäß derer absichtlich oder unabsichtlich die Fakten und Argumente ausgewählt oder verworfen werden. Eine solche Argumentationsweise soll hier als ideologisch bezeichnet werden.(16)
Ein besonders deutliches Beispiel für diesen Zusammenhang bietet die in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhundert in Blüte stehende Schädelkunde (vgl. Gould 1983), die durch exakte Messungen wissenschaftlich begründete Rangordnungen innerhalb der Menschen aufstellte und den 'Beweis' erbrachte, daß die Männer der weißen Rasse das größte Gehirnvolumen und deshalb die größte Intelligenz besitzen! Einer der einflußreichsten Theoretiker war der Franzose Paul Broca, und ihm folgten bedeutende Wissenschaftler. Als Beispiel sei nur Gustave Le Bon genannt, heute noch als Begründer der modernen Massenpsychologie anerkannt, der 1879 mit den Daten von Broca folgenden Angriff auf die Frauen begründete:
»Bei den intelligentesten Rassen, wie bei den Parisern, gibt es eine große Anzahl Frauen, deren Gehirn der Größe nach den Gorillas näher steht als den höchstentwickelten männlichen Gehirnen. Diese Unterlegenheit ist so offensichtlich, daß niemand sie auch nur einen Augenblick bestreiten kann; nur ihr Ausmaß lohnt die Erörterung. Alle Psychologen, die die Intelligenz von Frauen studiert haben, erkennen heute ..., daß sie eine der minderwertigsten Formen der Menschheitsentwicklung darstellen« (zit. nach Gould 1983, S. 108 f).
Die Überzeugungskraft der Theorien und Folgerungen der Kraniometrie beruhte auch darauf, daß die Ergebnisse dem Zeitgeist entsprachen. Da dieser Zeitgeist sich (zumindest teilweise) gewandelt hat und und inzwischen allgemein bekannt ist, daß die Intelligenzhöhe nicht mit dem Gehirnvolumen in Zusammenhang steht, fällt die ideologische Absicht sofort auf.(17)
Auch in der Pädagogik gibt es viele ideologische Argumentationen; erinnert sei nur an den Streit über die Gesamtschule. Ich verzichte jedoch auf ein konkretes Beispiel, denn es könnte in der hier gebotenen Kürze nicht analysiert werden: Einer Ideologiekritik muß der Nachweis wissenschaftlicher Fehler vorausgehen, aus denen eine bestimmte politische oder weltanschauliche Überzeugung als Grund der Fehler erschlossen werden kann. Wer diese Abfolge nicht beachtet und bereits den Hinweis auf bestimmte Überzeugungen als Kritik ausgibt, betreibt denunzierende Standpunktkritik, deren allgemeines Prinzip im Folgenden erläutert werden soll.
Bei der Beurteilung von Texten darf man sich nicht von einem bereits vorhandenem Vorverständnis zum behandelten Problem und den daraus quasi spontan entstehenden positiven oder negativen Urteilen über den Text leiten lassen. Denn sonst wird lediglich untersucht, ob der Text mit diesen Überzeugungen im Einklang steht oder ihnen widerspricht, um dann die festgestellte Identität oder Differenz als positives oder negatives Urteil über den Text vorzutragen.
Solche 'Kritik des Mißverstandes' (Feuerbach) tritt vor allem in zwei Varianten auf: In der methodischen Variante wird festgestellt, daß der Text empirisch, hermeneutisch, dialektisch usw. argumentiert; in der positionellen Variante wird der Text in eine bestimmte Richtung (konservativ, liberal, marxistisch, emanzipatorisch usw.) eingeordnet. Diese Einordnungen gelten dann, je nach eigenem Standpunkt, bereits als Lob oder Kritik des Textes. Nun mag die Erkenntnis, daß ein Text sich einer bestimmten Richtung verpflichtet, die Beurteilung erleichtern, sofern man sich mit ähnlichen Positionen bereits einmal befaßt hat. Aber: Die bloße Einordnung als Kritik vorzutragen ist nichts als schlechte Denunziation, die mit einem entsprechenden Vorurteil bei den Lesern und Leserinnen rechnet. Einzige Ausnahme: Ein Text, der sich von vorneherein nur an Gesinnungsgenossen und -genossinnen richtet, die in gemeinsamen Diskussionen sich einen bestimmten Standpunkt bereits erarbeitet haben. Hier kann die Benennung der Position genügen, da vorauszusetzen ist, daß die Leser und Leserinnen die Gründe, die zur Zustimmung oder Ablehnung führen, bereits kennen. Für alle anderen jedoch, die an diesem Diskussionszusammenhang nicht beteiligt sind, haben solche Urteile keinerlei Beweiskraft!
Abschließend sei noch auf eine beliebte Stilfigur aufmerksam gemacht, die Kritik nur vortäuscht: Bei kontrovers diskutierten Problemen ordnet ein neuer Text die vorhandenen Positionen oft in zwei gegensätzlich Extreme ein, um die eigene Position dann als den (goldenen) Mittelweg einzuführen. Solange diese Extreme jedoch nicht inhaltlich kritisiert werden, ist die Mitte nicht besser als die Extreme. Das Bild vom Pendel, das sich nach (zu) großen Ausschlägen im neuen Werk nun zur korrekten Lage eingependelt hat, ist ein weiteres Bild in diesem Zusammenhang, das mit dem Vorverständnis der Leser und Leserinnen rechnet, Extreme seien immer schlecht und die Mitte immer gut ...
* * *
In der Schule der Wissenschaft wird ...für die Praxis i
mmer zugleich zuviel und zuwenig gelernt. (Herbart)
Als die wesentlichen Aufgaben der Wissenschaft wurden weiter vorne die Beobachtung, Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und das Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten genannt. Gerade die Wünsche nach dem Aufweis von Handlungsmöglichkeiten bis hin zu konkreten Handlungsanweisungen stehen bei vielen Studierenden der Pädagogik im Vordergrund. Vom Studium selbst sind sie dann häufig eher enttäuscht; oftmals hört man die Klagen, es gebe so viele verschiedene Theorien, außerdem seien sie meist sehr abstrakt oder lebensfern, und die Kritik wird laut: »Das mag ja theoretisch alles sehr interessant sein, aber was nützt mir das für die Praxis?«
Nun ist nicht zu leugnen: Die Inhalte des Studiums sind eher selten im gewünschten Sinne konkret oder in der Praxis direkt anwendbar. Aber sind deshalb die Klagen und die Kritik wirklich berechtigt? Diese Frage soll nun unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert werden.
Die Studierenden im Fach Pädagogik streben verschiedene Studienabschlüsse an:
- Diplom in Pädagogik bzw. Magisterexamen mit Pädagogik als Hauptfach. Das Diplomstudium enthält in der Regel vorgeschriebene Nebenfächer, meist Psychologie und Soziologie, während im Magisterstudium die Nebenfächer weitgehend frei wählbar sind.
- Diplom oder Magisterexamen in einem anderen Hauptfach und Pädagogik als Nebenfach.
- Staatsexamen für ein Lehramt. Je nach der gewählten Schulart und den allgemeinen Richtlinien der Bundesländer enthält dieses Studium neben den Fächern, die sich auf die Inhalte des Unterrichts beziehen (Germanistik, Mathematik usw.), auch einen mehr oder weniger großen erziehungswissenschaftlichen Anteil.
Den verschiedenen Abschlüssen entsprechen verschiedene Berufsziele, Berufswünsche bzw. Berufsmöglichkeiten. Am einfachsten sind sie bei den Lehramtsstudierenden zu benennen: Lehrer oder Lehrererin an einer Schule (Grund- oder Hauptschule, Realschule, Gymnasium usw.). Bei den Studierenden im Diplom- oder Magisterstudiengang gibt es kein vergleichbar einheitliches Berufsbild, sondern ihre späteren beruflichen Tätigkeiten sind durch vielfältige Aufgaben und Funktionen geprägt. Die folgende Aufzählung beansprucht keine Vollständigkeit: Altenarbeit, Ausländerarbeit, Elementarerziehung, Erwachsenenbildung, Erziehungsberatung, Familienberatung, Familienbildung, Forschung, Freizeitpädagogik, Heimerziehung, Journalistik, Jugendarbeit, Jugendbildung, Kulturpädagogik, Lehre, Medienpädagogik, Museumspädagogik, Rehabilitation, Resozialisation, Schule, Sonderpädagogik, soziale Dienste, Therapie, Unterricht, Verbandsarbeit, Verkehrserziehung, Vorschulerziehung, Weiterbildung.
Die Vielfalt möglicher Berufe wird noch größer, wenn man die Studierenden berücksichtigt, die Pädagogik nicht als Hauptfach, sondern als Nebenfach im Rahmen eines anderen Magister- und Diplomstudiums gewählt haben. Ich verzichte auf weitere Beispiele, denn den Kombinationsmöglichkeiten sind hier kaum Grenzen gesetzt. Außerdem: Nicht alle Lehramtsstudierenden wollen oder können in den Schuldienst gehen und suchen dann ebenfalls Berufe außerhalb des Schulwesens. Dadurch erweitert sich die Zahl der Berufe nochmals, für die durch das Studium pädagogische Qualifikationen erworben werden sollen.
Selbst wenn man nur die Magister- bzw. Diplompädagogen und -pädagoginnen berücksichtigt, wird deutlich: Ihre jeweiligen beruflichen Tätigkeiten sind so vielfältig und unterschiedlich(18), daß durch das Studium eine spezielle Vorbereitung auf den späteren Beruf nicht möglich ist. Auch wenn, wie vor allem im Diplomstudiengang üblich, im Hauptstudium Schwerpunkte gesetzt werden, ändert sich das Problem nur graduell, nicht prinzipiell. Im Magisterstudiengang wird es durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fächer eher noch größer: Eine Kombination der Pädagogik mit semitischer Philologie und Islamwissenschaft zielt auf eine ganz andere Berufstätigkeit als eine Kombination mit Theaterwissenschaften und Psychologie. Aus der Formulierung in Informationsblättern oder Prüfungsordnungen, das Magisterexamen bzw. das Diplom in Pädagogik sei ein berufsqualifizierender Hochschulabschluß, kann deshalb nicht abgeleitet werden, daß das Studium für die konkreten pädagogischen Aufgaben in bestimmten Berufen qualifiziert. Mit dem entsprechenden Examen erreicht man einen Abschluß, der formal gesehen als Eingangsvoraussetzung bei vielen Berufen verlangt oder erwartet wird. Inhaltlich gesehen kann man im Studium meist eher allgemeine Qualifikationen erwerben, die eine schnelle und effektive Einarbeitung in die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Berufe gestatten sollen.
Diese Aussage muß angesichts der zusätzlichen Berufsfelder, die den Lehramtsstudierenden und den Nebenfachstudierenden offenstehen, noch betont werden: Zwar werden in vielen Studienordnungen durchaus Schwerpunkte gesetzt, zwar werden im Rahmen der Lehramtsstudiums oft spezifische schulpädagogische Probleme behandelt, aber allgemein gesehen gilt: Das Lehrangebot im Fach Pädagogik kann die Vielfalt pädagogischer Qualifikationen, die in den jeweiligen Berufen erforderlich sind, schon aus rein pragmatischen Gründen nicht abdecken und auf die speziellen Anforderungen nicht vorbereiten. Das im Studium Erlernbare ist in der späteren, konkreten Berufspraxis nur sehr selten direkt anwendbar. Wer deshalb beim Studienbeginn einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte pädagogische Tätigkeit vor Augen hat und erwartet, daß das Studium entsprechende konkrete Handlungsempfehlungen bietet, wird häufig enttäuscht sein.
Dafür ist jedoch nicht nur die beschriebene Vielfalt pädagogischer Berufe und Tätigkeiten verantwortlich, sondern es gibt auch inhaltliche, aus der pädagogischen Theorie selbst entspringende Gründe, weshalb die pädagogische Lehre (fast) keine direkten Handlungsanweisungen enthält. Vor allem trifft dies zu, wenn es um den unmittelbaren pädagogischen Umgang mit anderen Menschen geht. Einer dieser Gründe wird deutlich, wenn die Frage gestellt wird, unter welchen Voraussetzungen aus einer Theorie genaue Handlungsanweisungen ableitbar sind.(19)
Eine Anwendbarkeit von Theorie im Sinne genauer Anweisungen, was jeweils zu tun sei, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, findet man vor allem im Bereich des technischen Handelns. Es gibt dort eine Technologie, ein technologisches Wissen, das solche Anweisungen enthält.(20)
Beispiel(21): Es besteht der Wunsch, eine Brücke zu bauen. Ein Statiker oder eine Statikerin berechnet nun, wie dick die Stahlträger sein müssen, wie die Fundamente verankert werden müssen usw., um das gewünschte Gewicht tragen zu können. Auf dieser Grundlage kann dann eine technologische Bauanleitung erstellt werden.
Warum können solche Berechnungen vorgenommen werden, woher stammt das entsprechende Wissen? Die Berechnungen sind möglich, weil Erkenntnisse über Stahl vorliegen, die besagen: Wenn ein Stahlträger X cm dick ist, dann kann er das Gewicht Y tragen usw. Diese Erkenntnisse beruhen auf den Forschungsergebnissen der Experimentalphysik, die von der theoretischen Physik in die Form von Gesetzen gebracht wurden. Diese Gesetze lauten allgemein: Immer, wenn A vorhanden ist, folgt B; es handelt sich dabei um Kausalgesetze, A ist die Ursache und B die Wirkung.
Also: Wenn in einer theoretischen Grundwissenschaft allgemeine Gesetze über einen kausalen Zusammenhang von A (der Ursache) und B (der Wirkung) enthalten sind, dann kann eine technologische Anweisung abgeleitet werden, die besagt: Wenn die Wirkung B erreicht werden soll, muß die Ursache A erzeugt werden. Die Technologie geht also von Handlungsabsichten oder -zwecken aus, faßt sie als Wirkung und sucht bei der Bestimmung der Mittel, durch die ein Zweck erreicht werden kann, nach Ursachen, die diese Wirkung mit gesetzmäßiger Notwendigkeit hervorbringen.
Am Beispiel: Die Brücke ist errichtet, ein Auto fährt über sie - und sie hält! Ursache: Ein Hauptträger aus Stahl von bestimmter Dicke wurde beim Bau verwendet. Wirkung: Er kann ein bestimmtes Gewicht tragen, ohne zu brechen.
Diese kurze Analyse des technischen Handelns zeigte, zusammenfassend formuliert: Wenn ein bestimmter Wunsch, eine bestimmte Absicht besteht, muß geprüft werden, ob es in den Grundwissenschaften Gesetze gibt, in denen dieser Wunsch als Wirkung einer (oder mehrerer) Ursachen beschrieben wird; wenn ja, kann eine technologische Anweisung abgeleitet werden, was zu tun sei, um die Absicht zu realisieren, wenn nein, ist die Absicht nicht realisierbar - es sei denn, die Forschung kommt zu neuen Ergebnissen.
Die Voraussetzungen für technologische Handlungsanweisungen, die angeben, wie ein gewünschter Zweck erreichbar ist (und zwar mit Erfolgsgarantie, sofern keine Fehler gemacht werden!), sind damit Theorien, die in der Form allgemein gültiger Kausalgesetze vorliegen.
Sind diese Voraussetzungen im Bereich der Wissenschaft von der Erziehung vorhanden oder herstellbar? Die erste Teilfrage kann leicht beantwortet werden: Sie sind nicht vorhanden, die pädagogische Wissenschaft kann keine Theorien anbieten, die solche allgemein gültigen Kausalgesetze enthalten.
Der Grund dafür liegt nicht etwa darin, daß die Suche nach solchen Theorien noch niemals als Aufgabe gesehen wurde. Die sogenannte empirische oder kritisch-rationale Richtung der Erziehungswissenschaft hatte beispielsweise vor knapp zwanzig Jahren ausdrücklich postuliert: »Im Hinblick auf die in der Erziehungspraxis zu lösenden Probleme ist die Erziehungswissenschaft in erster Linie eine technologische Wissenschaft« (Brezinka 1972, S. 32). Sie forderte deshalb, in der Erziehungswissenschaft nach Kausalgesetzen (oder ersatzweise nach statistischen Gesetzmäßigkeiten) zu suchen und auf dieser Grundlage eine »Technologie der Erziehung« (ebda S. 253) zu erstellen. Jedoch bietet auch sie bis heute keine solchen Gesetze an, geschweige denn eine Technologie. Dies wird von Vertretern dieser Richtung häufig auf die (quantitative) Komplexität des Forschungsgegenstandes Mensch zurückgeführt, aber ich denke, dafür ist ein anderer, qualitativer Grund verantwortlich, der in der folgenden These benannt werden soll, wodurch gleichzeitig eine Antwort auf die zweite Teilfrage gegeben wird.
These:(22) »Technologie« bedeutet im technischen Bereich die Umwandlung von Rohstoffen in ein Fertigprodukt; wenn dieser Begriff auf den Bereich der Erziehung übertragen wird, muß der (junge) Mensch als ein noch unfertiges und von außen formbares »Aggregat von elementaren Stoffen und Kräften« (Litt 1967, S. 95) betrachtet werden, formbar auf Grund innerer Kausalgesetze zu einer vom Erzieher gewünschten Endgestalt.
Solche Kausalverhältnisse existieren zwar bei den (Roh)Stoffen, mit denen es das technische Handeln zu tun hat, aber nicht im Bereich des Humanen, um den es im pädagogischen Handeln geht. Menschen sind keine Ursache-Wirkungs-Mechanismen; auch der junge, heranwachsende Mensch, mit dem sich die Pädagogik vorrangig beschäftigt(23), ist niemals bloß das Objekt auf ihn wirkender Einflüsse, sondern selbst das Subjekt seines Lernens und seiner Entwicklung, begabt mit einem eigenen Willen, eigenen Absichten, eigenen Wünschen usw. Ihn als ein solches Subjekt des eigenen Tuns anzuerkennen ist nicht nur eine moralisch oder philosophisch begründbare Forderung, sondern entspricht auch Erkenntnissen der Anthropologie oder der modernen Entwicklungspsychologie, die längst von der Vorstellung eines jungen Menschen als 'tabula rasa' oder durch Erziehung konditionierten bzw. konditionierbarem Wesen Abschied genommen haben.(24)
Ein kleines, vereinfachtes Beispiel zur Verdeutlichung dieser These. Viele Kinder, die in einem überzeugt religiösen Elternhaus aufwachsen, z.B. in einem evangelischen Pfarrhaushalt, werden zu gläubigen Christen, und gar manche von ihnen wählen später selbst aus innerer Berufung den Beruf des Pfarrers - es gibt Familien, in denen es fast schon Tradition ist, daß in jeder Generation ein Sohn wieder Pfarrer wird. Die Erklärung, die dafür oft vorgetragen wird, lautet in etwa: Ein Kind, das in eine Familie geboren wird, die den christlichen Glauben sowohl verkündet als auch danach lebt, wird entsprechend geprägt; das Aufwachsen in einer solchen Familie, verbunden mit der Tatsache, daß für Kinder die Eltern Vorbilder sind, mit denen sie sich identifizieren, führt geradezu notwendig dazu, daß es deren Überzeugungen verinnerlicht und selbst nach ihnen lebt.
Nun könnte man folgern: Wenn Eltern wollen, daß ihre Kinder zu gläubigen Christen werden, dann müssen sie diese erstens von früh auf mit den Inhalten des Glaubens bekanntmachen und zweitens selbst vorbildhaft und wahrhaftig als Christen leben.
Aber: Es gibt auch die entgegengesetzte Tatsache. Es gibt Menschen, die in solchen Familien aufwuchsen und zu Atheisten wurden. Auch hier ist man mit der Erklärung schnell bei der Hand, sie lautet dann: Kinder, die in einer derart religiös bestimmten Familie aufwachsen, werden bei dem ersten Konflikt mit den Eltern, der spätestens in der Pubertät auftritt, sich gerade gegen das wehren, was den Eltern am wichtigsten ist bzw. wo sie sich am meisten bevormundet fühlen - also gegen den Glauben. Um zu sich selbst zu kommen, müssen sie sich von den übermächtigen Einflüssen des Elternhauses freimachen und werden deshalb mit innerer Notwendigkeit zu Atheisten.
Also könnte man folgern: Wenn Eltern wollen, daß ihre Kinder zu Atheisten werden, dann müssen sie diese erstens von früh auf mit den Inhalten des Glaubens bekanntmachen und zweitens selbst vorbildhaft und wahrhaftig als Christen leben - beim ersten massiven Konflikt mit den Eltern werden sich dann die Kinder gegen den Glauben wenden!(25)
Was lehrt dieses Beispiel? Meiner Ansicht nach folgendes: Zwar sind die Einflüsse, denen ein Kind ausgesetzt ist, die Erfahrungen, die es macht, sicherlich bedeutsam für seine spätere Entwicklung - aber diese Einflüsse führen nicht notwendig zu vorhersagbaren Wirkungen, es gibt keine strenge Kausalität. Da schon ein Kind ein Subjekt seines Lernens und seiner Entwicklung ist, kommt es immer auch darauf an, wie es diese Einflüsse und Erfahrungen verarbeitet, was es daraus macht. Alle Absichten, Kinder und Jugendliche in einer bestimmten Richtung zu beeinflussen, können an ihren Eigen-Willen scheitern. Es gibt keine Handlungsanweisungen, die auch nur ähnlich erfolgreich sind wie die Anweisungen beim technischen Handeln. Und selbst wenn manche Regel in der Mehrzahl der Fälle erfolgreich ist, liegt keine Kausalität wie im technischen Bereich vor, sondern die Kinder oder die Jugendlichen haben dann ihren Teil dazu beigetragen und das, was ihnen angetragen oder vorgesetzt wurde, aktiv übernommen.
Wenn deshalb zutrifft, wie in der These behauptet, daß der (junge) Mensch ein Subjekt ist, dann kann es keine allgemeinen Kausalgesetze über ihn geben, und es können keine technologischen Handlungsanweisungen für die Erziehung erstellt werden. Zu diesem Ergebnis kam auch Litt bei seiner Analyse des pädagogischen Denkens: »Die Form einer Technologie kann .. die Theorie der Erziehung unter keinen Umständen annehmen« (Litt 1967, S. 96).
Aber selbst wenn man dieser These vom (jungen) Menschen als Subjekt seiner Entwicklung und seines Lernens, die von der (inneren) Freiheit des Menschen ausgeht, nicht zustimmt und auf seiner kausalen Determination beharrt, gibt es einen weiteren Grund, weshalb die pädagogische Theorie keine technologischen Handlungsanweisungen formulieren kann. Ein Grund, der gleichzeitig auch dafür verantwortlich ist, daß die pädagogischen Theorien häufig so abstrakt sind und die pädagogische Praxis nicht als Anwendung von Theorien begriffen werden kann.
Technologien haben nämlich noch eine weitere Voraussetzung, die oben zwar schon implizit angesprochen, aber nicht explizit ausgeführt wurde: Die Stoffe und Materialien derselben Art, mit denen es das technische Handeln zu tun hat, gleichen sich so weitgehend, daß z.B. eine gültige allgemeine Aussage oder ein Gesetz über die Eigenschaften etwa von Stahl für jedes beliebige Stück an jedem beliebigen Ort der Erde zutrifft. Wer irgendwo auf der Welt den Plan für eine Stahlbrücke entwirft, kann deshalb auf die allgemeinen Erkenntnisse über die Eigenschaften von Stahl zurückgreifen und aus ihnen ableiten, wie der Hauptträger konstruiert werden muß, um die gewünschte Belastbarkeit der Brücke zu erreichen.
Diese Voraussetzung ist jedoch im Bereich des Humanen nicht gegeben. Menschen sind jeweils einzigartig, bereits was ihre Gene oder die Feinstruktur ihres Gehirns betrifft, noch mehr, was die Ergebnisse ihrer Entwicklung und ihres Lernens betrifft (vgl. Fischer 1988 und Asendorpf 1988).
Die erste Konsequenz aus dieser Tatsache: Selbst wenn jeder einzelne Mensch vollständig determiniert wäre, es also für jeden einzelnen gültige Kausalgesetze und daraus ableitbare technologische Anweisungen geben würde, gäbe es keine allgemeinen Gesetze und Regeln, die analog wie die allgemeinen Gesetze der Naturwissenschaft anwendbar sind.
Um es am obigen Beispiel zu verdeutlichen: Angenommen, die beschriebenen unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern werden nicht auf ihr Subjekt-Sein zurückgeführt, sondern durch ihre je spezifische Erbanlagen erklärt, die bewirken, daß sie auf identische Einflüsse unterschiedlich reagieren, und zwar determiniert durch diese Erbanlagen. Auch dann zeigt das Beispiel, daß allgemein anwendbare Technologien nicht erstellt werden können, denn dies würde - im Widerspruch zu dieser Erklärung - voraussetzen, daß jeder Mensch auf dieselben Einflüsse in derselben Art und Weise reagiert.(26)
Ein zusätzlicher, aber wichtiger Gesichtspunkt muß kurz noch erwähnt werden: Nicht nur die (jungen) Menschen sind individuelle Personen, sondern auch die Pädagogen und Pädagoginnen. Beim Handeln im technischen Bereich spielt nun die Persönlichkeit der Handelnden keine Rolle, denn zwischen den Handelnden und dem Material, das sie bearbeiten, besteht nur eine äußerliche Beziehung. Anders ist es beim Handeln im pädagogischen Bereich, denn hier besteht oder entsteht eine innere Beziehung zwischen den Beteiligten, ein pädagogisches Verhältnis, das durch viele Faktoren bestimmt ist: Durch die individuelle Persönlichkeit der Kinder und die Erfahrungen, die sie mitbringen, durch die je konkrete pädagogische Situation samt ihrer Vorgeschichte, usw. - aber auch, und darauf kommt es hier an, durch die individuelle Persönlichkeit der Pädagogen und Pädagoginnen. Pädagogische Handlungen sind deshalb nicht trennbar von den handelnden Personen; ihre jeweilige Persönlichkeit ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, der das pädagogische Verhältnis und darüber den Erfolg oder Mißerfolg ihrer Handlungen mitbestimmt. Pädagogen und Pädaginnen müssen ihren eigenen 'Stil' finden, abgestimmt auf die eigene Persönlichkeit und in realistischer Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, der individuellen Stärken und Schwächen. Es gibt keine 'Rezepte', die bei allen gleichermaßen wirken.
Aus der Tatsache unterschiedlicher Individualität folgt jedoch noch eine weitere Konsequenz: Aussagen über 'die' Menschen müssen von den individuellen Besonderheiten abstrahieren, um auf einer allgemeineren Ebene übergreifende Gemeinsamkeiten (die es natürlich gibt!) feststellen zu können. Je allgemeiner die Aussage, für je mehr Menschen sie also gelten soll, desto abstrakter muß sie sein und desto weniger erfaßt sie von den individuell-konkreten Eigenschaften eines Menschen. Genau diese sind es jedoch, die das subjektive Erleben und Handeln in der lebendigen Wirklichkeit letztlich bestimmen!
Oder umgekehrt: Je mehr sich eine Aussage der subjektiven Erlebniswirklichkeit nähert, desto eingeschränkter ist ihr Geltungsbereich in dem Sinne, daß sie nur für wenige Menschen oder nur unter bestimmten Bedingungen gilt. Konkrete Einzelfallanalysen, die individuelle Besonderheiten und/oder die individuelle Lebensgeschichte einbeziehen, sind für die Forschung wichtig und notwendig, aber sie sind als solche nicht ohne weiteres auf andere Menschen übertragbar und ergeben keine Theorie. Um zu allgemeinen Aussagen zu gelangen, müssen deshalb die Einzelfälle verglichen werden, um zu sehen, was sind nur individuelle Merkmale, Besonderheiten usw., und wo liegen Gemeinsamkeiten, die dann als etwas Allgemeines festgehalten und in einer Theorie erfaßt werden können.
Theorien haben deshalb, je nachdem wie weit die Abstraktion vorangetrieben wird, unterschiedliche Reichweiten: Aussagen über die Erziehung von Kindern in der deutschen Nachkriegszeit gelten nicht notwendig für das Aufwachsen in Deutschland allgemein, Aussagen über die Erziehung von Kindern in Deutschland nicht für andere Kulturkreise usw. Durch diese zwar unterschiedlich weite, aber immer notwendige Abstraktion entsteht eine Differenz zwischen der pädagogischen Theorie und der (ihr vorausgesetzten) Erziehungswirklichkeit, damit aber auch eine Differenz zwischen der pädagogischen Theorie und der (ihr nachfolgenden) pädagogischen Praxis, die es ja mit dieser Wirklichkeit zu tun hat, mit individuell konkreten (jungen) Menschen in einmaligen Situationen. Deshalb sind auch die Orientierungen, Empfehlungen oder Ratschläge für die Praxis, die in der wissenschaftlichen Pädagogik gegeben werden, notwendigerweise (mehr oder weniger) abstrakt-allgemein; sie können auch jenseits technologischer Absichten nicht einfach in der Praxis angewandt werden. Die allgemeine pädagogische Theorie kann die spätere Praxis mit ihren vielfältigen konkreten Situationen nie vollständig antizipieren. Damit aber kann sie weder für diese Situationen vollständige Erklärungsmuster anbieten noch für den möglichen Einzelfall konkrete Handlungsanweisungen geben. Auf dieses Problem machte Herbart schon 1802 in der erste Stunde seiner Vorlesung über Pädagogik aufmerksam:
»Die Theorie in ihrer Allgemeinheit erstreckt sich über eine Weite, von welcher jeder Einzelne in seiner Ausübung nur einen unendlich kleinen Teil berührt; sie übergeht wieder in ihrer Unbestimmtheit, welche unmittelbar aus der Allgemeinheit folgt, alles das Detail, alle die individuellen Umstände, in welchen der Praktiker sich jedesmal befinden wird, und alle die individuellen Maßregeln, Überlegungen, Anstrengungen, durch die er jenen Umständen entsprechen muß. In der Schule der Wissenschaft wird daher für die Praxis immer zugleich zuviel und zuwenig gelernt« (Herbart 1982, S. 124 f).
Daraus folgt, um auf den Beginn des Kapitels zurückzukommen: So verständlich der Wunsch der Studierenden nach genauen Handlungsanweisungen für ihre spätere Praxis und ihre Klage über abstrakte Theorie auch sein mag - der Wunsch kann nicht erfüllt und das Beklagte nicht geändert werden. Das (technologische) Anwendungsmodell wird dem Theorie-Praxis-Verhältnis in der Pädagogik nicht gerecht.(27)
Daraus darf jedoch nicht der Schluß gezogen werden, die wissenschaftlichen Theorien würden nur der Erkenntnis dienen: Auch wenn keine direkte Anwendung möglich ist, besteht ein Nutzen für die Praxis. Ein Beispiel - ich übernehme es von Giesecke (1990, S. 185) - kann dies verdeutlichen:
»Ein Lehrer stellt fest, daß einer seiner vierzehnjährigen Schüler plötzlich schlechte Noten bekommt, während er vorher ein scheinbar unkomplizierter guter Durchschnittsschüler war. Was kann der Lehrer nun tun? Unsere Wissenschaft stellt ihm keine Theorie dieses einen Schülers zur Verfügung, in der er nachschlagen könnte, was nun zu tun sei. Er muß vielmehr eine Menge von dem, was er gelernt hat, auf diesen Falle anwenden, um ihn zu verstehen. Er kann sich zum Beispiel folgende Fragen vorlegen: Leidet der Junge unter einem Konflikt mit seinen Eltern? Leidet er an einer unglücklichen Liebe? Ist er bloß faul und aufsässig? Hat er vielleicht Konflikte mit seinen Klassenkameraden, die ihn belasten? Habe ich, der Lehrer, ihn nicht genügend ermutigt, so daß sein Lerneifer gehemmt wurde? Oder ist einfach seine Leistungsgrenze erreicht und er kann gar nicht mehr leisten, als er jetzt bereits versucht?« Diese Fragen, so Giesecke, entstehen auf der Grundlage allgemeiner Theorien, die der Lehrer sich angeeignet hat und kennt, z.B. »einer Theorie der Familie, einer Theorie des Lernens, einer Theorie des Jugendalters usw.«
Der individuell-konkrete Fall erscheint also zunächst als ein Problem, und es müssen Fragen gestellt werden, um gezielt nach weiteren Informationen und Fakten suchen zu können, durch die das Problem erklärt oder verstanden werden kann. Welche Fragen dabei gestellt werden, hängt von den allgemeinen theoretischen Kenntnissen ab; sie bestimmen den Fragehorizont und zeigen an, in welchen Bereichen möglicherweise die Gründe liegen. Das bedeutet: Je weniger Wissen vorhanden ist, desto größer wird die Gefahr, daß Symptome nicht erkannt oder falsch interpretiert werden.(28) Die theoretischen Kenntnisse sind also zunächst wichtig für eine zutreffende Diagnose.
Nach der Diagnose muß über das Handlungsziel entschieden werden. Diese Entscheidung setzt die Antworten auf die Fragen voraus: »Was kann erreicht werden?« und »Was soll erreicht werden?« Diese Antworten hängen einerseits von der Diagnose selbst ab - wenn sie im obigen Beispiel etwa lautet »Leistungsgrenze erreicht« wird sie anders ausfallen als wenn sie lautet »Konflikte mit den Klassenkameraden«. Sie hängen andererseits von den allgemeinen Erziehungszielen ab, die der Lehrer für richtig und wichtig hält: Wenn im Beispiel Konflikte der Grund sind, kommt es bei der Entscheidung darauf an, welche Bedeutung der Lehrer den Persönlichkeitsmerkmalen Belastbarkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Kompromißfähigkeit usw. zumißt.
Und schließlich muß noch geklärt noch werden, wie das angestrebte Ziel am besten erreicht werden kann. Zwar wird der Lehrer aus der Theorie nicht unmittelbar ablesen können, wie er sich angesichts des konkret-individuellen Falls entscheiden soll, aber er wird Argumente für und gegen die einzelnen Zielvorstellungen und verschiedene Handlungswege aufgezeigt finden, die er auf seinen Fall beziehen kann. Seine theoretischen Kenntnisse sind damit nicht nur für die Diagnose nützlich, sondern geben ihm auch Orientierungen für die Entscheidung über seine Handlungsziele und seine Handlungsweise.
Das bedeutet, allgemein gesprochen: Die oben beschriebene Differenz zwischen der Theorie und der Erziehungswirklichkeit kann und soll durch eine eigenständige, produktive Leistung überbrückt werden. Die Aufgabe liegt darin, ausgehend von den Beobachtungen der Praxis den konkret-individuellen Fall mit Hilfe einer oder auch der Kombination mehrerer Theorien zu erklären, um auf dieser Grundlage zu überlegen und zu planen, wie im pädagogischen Handeln darauf reagiert wird. Auch wenn die pädagogische Theorie nicht direkt in der Praxis angewandt werden kann, ist sie also keineswegs nur 'graue Theorie': Sie stellt ein Wissen für die Reflexion über die Praxis zur Verfügung und ermöglicht, diese Praxis genauer zu erkennen und die richtigen Schlüsse für das Handeln zu ziehen.
* * *
Es gibt nichts Praktischeres als eine
gute pädagogische Theorie. (Langeveld)
Im letzten Kapitel wurde ein Fall geschildert, der einem Lehrer beim Nachdenken über seine Praxis auffiel und der keine sofortige Reaktion erforderte. Er hatte Zeit für das diskursive(29) Denken, er konnte in Ruhe analysieren und sich bewußt für bestimmte Maßnahmen entscheiden.
Jedoch: Diese Zeit steht nicht immer zur Verfügung, und zwar wegen einer Besonderheit der pädagogischen Praxis, die sofort deutlich wird, wenn man sie etwa mit der medizinischen vergleicht. In der medizinischen Praxis ist es der Normalfall, daß Ärzte und Ärztinnen, wenn sie bei der Diagnose unsicher sind, weitere Befunde erheben oder in Lehrbüchern nachschlagen. Entsprechendes gilt für die Frage, welche therapeutischen Maßnahmen im konkreten Einzelfall erforderlich oder angebracht sind. Sich diese Zeit zu nehmen ist kein Verstoß gegen die ärztliche Kunst und bringt für die Kranken eher Vorteile. Nur in Ausnahmen, in Notfällen ist eine sofortige Diagnose und die unverzügliche Einleitung therapeutischer Maßnahmen erforderlich, nur hier dürfen Ärzte und Ärztinnen nicht zögern und lange überlegen.
Die Ausnahmesituation, der Notfall der medizinischen Praxis ist, wenn auch (fast) nie so dramatisch, der Normalfall der pädagogischen Praxis: Die pädagogische Situation erfordert in der Regel ein unmittelbares, schnelles Agieren oder Reagieren. Dies hängt damit zusammen, daß in der unmittelbaren Situation die Pädagogen und Pädagoginnen nicht 'Nicht-Handeln' können: Ein Abwarten, ein Aufschieben einer Entscheidung bis mehr Informationen vorhanden sind, Hinweise, man müsse erst überlegen oder sich mit Fachleuten beraten usw., sind nicht etwa ein Aufschub pädagogischer Handlungen (wie sie analog ein Aufschub medizinischer Handlungen wären), sondern selbst pädagogische Handlungen. Es hängt von der jeweiligen pädagogischen Tätigkeit und Situation ab, ob sie zweckmäßig sind oder nicht: In einer Unterrichtssituation bei einer Frage zu sagen, daß man erst überlegen oder zu Hause nachlesen müsse, dürfte in der Regel akzeptiert werden (sofern diese Antwort nicht dauernd erfolgt ...); bei einer massiven Unterrichtsstörung hingegen dürfte diese Reaktion eher kontraproduktiv sein.
Also: Neben den Fällen, wo die Pädagogen und Pädagoginnen Zeit haben oder sich Zeit nehmen können, um gründlich nachzudenken und reflektiert zu entscheiden, gibt es Situationen, wo unmittelbare, schnelle Handlungen und Reaktionen erforderlich sind. Diese sind aber nicht schon deshalb richtig, weil sie schnell erfolgen - sie müssen auch inhaltlich gesehen der jeweiligen Situation angemessen sein. Ein schnelles Handeln ist jedoch meist ein spontanes Handeln, mehr einem Gefühl und innerem Impuls folgend als auf Überlegung und bewußter Entscheidung beruhend - und betrachtet man das Alltagsgeschäft der Pädagogen und Pädagoginnen, so ist wohl die Mehrzahl ihrer Handlungen in diesem Sinne spontan.
Damit aber entstehen die Fragen: Sind die theoretischen Kenntnisse nur dann nützlich, wenn genügend Zeit für eine Reflexion zur Verfügung steht? Oder kann das schnelle, spontane Handeln in Einklang gebracht werden mit dem Handeln, zu dem man sich bei gründlicher Überlegung entschließen würde? Um diese Frage zu beantworten soll jetzt genauer betrachtet werden, durch welche Faktoren dieses Handeln beeinflußt wird und von welchen Voraussetzungen es abhängt.
Die Fähigkeit zum schnellen, spontanen Handeln in pädagogischen Situationen setzt in der Regel eine gewisse Übung oder Erfahrung voraus. Dies wird deutlich, wenn man die Handlungsweisen in neuen Situationen mit denjenigen vergleicht, die sich herausbilden, wenn diese Situationen in strukturell ähnlicher Weise wiederholt auftreten.
Wohl alle kennen den Unterschied aus eigener Erfahrung, ob man eine Tätigkeit oder Aufgabe zum ersten Mal erledigt oder zum wiederholten Mal. Als Beispiele erinnere ich nur an den Umgang mit (kleinen) Kindern, sei es beim ersten eigenen Kind oder als Babysitter, oder an die Leitung eines Ferienlagers: Beim ersten Mal ist vieles oder alles neu und unbekannt, man ist oft unsicher, was in einer konkreten Situation zu tun sei. Man achtet dann aufmerksam darauf, ob die Handlungen, zu denen man sich entschließt, auch den gewünschten Erfolg haben und versucht gegebenenfalls, andere Varianten auszuprobieren. Das, wozu man sich in solchen Situationen jeweils entschließt, ist genau betrachtet von verschiedenen Komponenten abhängig:(30)
a) Von der Wahrnehmung konkreter Situationen, in denen ein Handlungsbedarf besteht. Diese Wahrnehmung ist (meist) nicht nur reine Beobachtung: Das menschliche Gehirn registriert Sinnesdaten nicht einfach wie eine Filmkamera oder ein Tonbandgerät, sondern interpretiert sie sogleich und verleiht ihnen Bedeutung, falls dem Beobachteten ein Wissen oder eine Erfahrung zugeordnet werden kann - das Schreien des Kindes ist ein hungriges, ein zorniges Schreien, ein Schreien, das Schmerz ausdrückt usw. Diese Verknüpfung sinnlich aufgenommener Daten mit einem vorhandenen Wissen bzw. mit früherer Erfahrung erfolgt unterbewußt als automatischer Vorgang im Gehirn - was nicht ausschließt, daß oft auch bewußt nachgedacht wird: Dies ist z.B. dann der Fall, wenn die unterbewußte Verknüpfung lediglich im Bewußtsein meldet, daß etwas bekannt ist, ohne zugleich den Inhalt mitzuliefern. Außerdem lösen diese Wahrnehmungen häufig ein Gefühl aus, Sorge, Erleichterung, Ärger, Mitleid, Empörung usw. Diese Gefühle enthalten ihrerseits einen Handlungsimpuls: Bei Sorge will man genauer überprüfen, was los ist, bei Mitleid will man helfen, bei Empörung strafen usw.
b) Von den eigenen Einstellungen, Überzeugungen, Wertvorstellungen bzw. dem, was man an allgemeinen Handlungsempfehlungen oder Regeln kennt und für richtig bzw. falsch hält. Ob man z.B. ein Kind durch Schläge straft hängt davon ab, ob man (leichte) Schläge für ein legitimes Erziehungsmittel hält oder nicht; ob eine Mutter einem hungrig schreienden Säugling sofort die Brust gibt oder nicht hängt davon ab, ob sie der Überzeugung ist, daß der Hunger sofort gestillt werden soll oder ob sie einen regelmäßigen Stillrhythmus für notwendig hält.
c) Von den Annahmen darüber, was in der wahrgenommen konkreten Situation geeignet sei, eine bestimmte Absicht, einen Zweck zu erreichen, wobei diese Absicht von den Überzeugungen und/oder den situativ entstandenen Gefühlen abhängen kann.
Die in einer neuen Situation entstehenden Unsicherheiten können bei jeder dieser Komponenten auftreten:
- Auf der Ebene der Beobachtungen: Man ist sich unsicher, was eine beobachtete Situation oder Handlung bedeutet, kann sie nicht interpretieren oder einordnen. Beispiel: Man beobachtet im Ferienlager Vierzehnjährige, die sich umarmen, küssen und mit einer Decke im Wald verschwinden: Wollen sie nur ungestört schmusen? Oder ist es der Beginn von mehr?
- Auf der Ebene der Überzeugungen: Bezogen auf ein konkretes Problem hat man noch keine Überzeugungen gewonnen, oder sie sind zu allgemein, als daß von ihnen aus der konkrete Fall beurteilt oder bewertet werden könnte. Beispiel: Wie bewertet man sexuelle Handlungen Jugendlicher? Hält man einen Geschlechtsverkehr Vierzehnjähriger für zu früh? Und wie steht es mit der Verantwortung gegenüber den Eltern oder der Aufsichtspflicht in einem Ferienlager?
- Auf der Ebene erfolgversprechender Handlungen: Wie soll man reagieren, um den gewünschten Zweck zu erreichen? Beispiel: Man interpretiert die geschilderte Beobachtung als Auftakt zu mehr und will eingreifen (wegen der Verantwortung bzw. der Aufsichtspflicht und/oder weil man die Jugendlichen für zu unreif hält und/oder aus Angst vor Schwangerschaft wegen vermuteter Unwissenheit über Verhütungsmittel). Was soll man tun? Auf Einsicht setzen und ein aufklärendes Gespräch führen? Oder ist ein strenges Verbot besser, verbunden mit dem Versuch, Gelegenheiten zu verhindern? Oder was sonst?
Dieses Beispiel belegt nochmals die obige Behauptung über die Notwendigkeit schneller Entscheidungen beim pädagogischen Handeln: Die Leiter und die Leiterinnen können ihre Entscheidung höchstens kurzfristig aufschieben, sie müssen handeln, sie können nicht 'Nicht-Handeln'. Auch wenn sie vielleicht subjektiv glauben, durch schlichtes Ignorieren einer Entscheidung auszuweichen, ist das objektiv und von der Wirkung her betrachtet ein pädagogischer Akt, nämlich ein Dulden, ein Gewährenlassen, ein Akzeptieren. Sie werden sich wohl auch recht schnell entscheiden, irgendwie, eher aus einem Gefühl heraus, was richtig sei, und werden beobachten, was sich ereignet, ob sie dabei Erfolg haben oder nicht. Und sie werden (hoffentlich) hinterher nachschauen, was in der sexualpädagogischen Literatur zu finden ist, wie die rechtliche Lage aussieht, sich möglicherweise mit anderen, erfahrenen Pädagogen und Pädagoginnen über das Problem unterhalten usw.
Jedenfalls: Wenn sie die zehnte Freizeit leiten und zum wiederholten Mal mit einer analogen Situation konfrontiert sind, werden sie ohne große innere Unsicherheit unmittelbar-spontan reagieren, auf Grundlage ihrer bis dahin gewonnenen Erfahrungen und/oder ihrer Lektüre, eigener Überlegungen und Gespräche. Das bedeutet: Durch fortgesetzte, wiederholte Tätigkeit oder Übung bildet sich auf der Grundlage von Erfahrungen und Überzeugungen nach und nach die Fähigkeit aus, Beobachtungen rasch zu interpretieren, sie von den eigenen Überzeugungen her zu beurteilen und sich schnell zu einer Handlung zu entschließen.
Diese Interpretationen, Beurteilungen und Entschließungen sind dabei jedoch selten als solche bewußt, sondern werden habitualisiert(31); daß sie aber dennoch erfolgen, wird beispielsweise deutlich, wenn die Frage gestellt wird »Warum haben Sie das gemacht?«: In der Antwort werden dann nämlich meist auch Interpretionen usw. benannt, die in der konkreten Situation nicht deutlich bewußt waren, aber faktisch das Handeln bestimmten.
Die Habitualisierung kann dabei in extremer Ausprägung zu starren Gewohnheiten, zu stereotypen Abläufen führen, in denen schon einige oberflächliche Beobachtungen genügen, um ein Handeln 'nach Schema F' in Gang zu setzen. Aber eine solche Verfestigung und Starrheit erfolgt nicht zwangsläufig (und ist auch keine notwendige Voraussetzung für schnelles Handeln): Es ist durchaus möglich, daß auch in den raschen Interpretationen und Beurteilungen die jeweilige Individualität der Beteiligten oder die spezifische Besonderheit einer Situation (mehr oder weniger) einbezogen und dann im Handeln berücksichtigt werden, das schnell, ohne innere Unsicherheit und in der subjektiven Gewißheit erfolgt, das Richtige zu tun. Ein solches Handeln bezeichnet Herbart als ein Handeln, das durch den pädagogischen Takt als den unmittelbaren Regenten der Praxis bestimmt ist (1982 S. 126).
Der Begriff 'Takt' klingt heute etwas altmodisch, und seine Verwendung ist eingeschränkt auf Situationen, in denen jemand verletzlich ist: Wenn einem Menschen bescheinigt wird, mit Taktgefühl oder taktvoll gehandelt zu haben, dann soll damit ausgedrückt werden, daß er die individuelle Lage eines anderen Menschen schnell erfaßte, zutreffend beurteilte und in einer Art handelte, die dem anderen Menschen in einer schwierigen Situation half, ihn zumindest nicht verletzte.
Diese Momente sind auch im Begriff des Taktes bei Herbart enthalten, der ihn allerdings umfassender verwendet: Der pädagogische Takt ist nicht nur in schwierigen, sondern in allen pädagogischen Situationen erforderlich (aber vielleicht sind ja alle pädagogischen Situationen schwierig und die Betroffenen leicht verletztlich ...). Auch wenn er, wie gesagt, altmodisch klingt: Ich nehme den Begriff Takt auf, weil ich keinen besseren kenne, um das, was durch ihn ausgedrückt werden soll, zu bezeichnen.(32) Pädagogisches Handeln, das durch den Takt als unmittelbaren Regenten der Praxis bestimmt ist, enthält folgende Merkmale:
1. Es ist ein Handeln (eher) aus den Gefühlen und Impulsen heraus, die in oder durch pädagogische Situationen entstehen; es ist dabei ein schnelles Handeln, d.h. ein spontanes Agieren und Reagieren, ohne langes Zögern. Spontanes Handeln ist aber nicht immer bereits taktvoll, es kann umgekehrt sogar leicht zu Grobheit und Verletzung führen. Deshalb muß ein weiteres Merkmal hinzukommen, und zwar:
2. Es ist ein Handeln, bei dem intuitiv(33) das Richtige getan wird. Damit soll ausgedrückt werden: Auch ohne bewußte Reflexion werden die richtigen Entscheidungen getroffen, es besteht keine innere Unsicherheit, was zu tun sei.
Der pädagogischen Takt als unmittelbarer Regent der Praxis kann damit beschrieben werden als die Fähigkeit zum schnellen, intuitiv richtigen Handeln.(34)
Der Takt bildet sich, wie bereits beschrieben, durch die Erfahrungen der Praxis, den Empfindungen, Gefühlen und spontanen Handlungsimpulsen, die bei Wiederholung und Übung habitualisiert werden. Allerdings wurde bei dieser Beschreibung ein Gesichtspunkt nur nebenbei erwähnt, der jetzt genauer betrachtet werden soll: Diese Empfindungen, Gefühle und Handlungsimpulse sind individuell unterschiedlich, und zwar abhängig von den je subjektiven Vorstellungen und Überzeugungen.
Zunächst wieder ein Beispiel. Man stelle sich zwei verschiedene Freizeiten vor, jeweils mit noch unerfahrenen Leitern, bei denen die oben geschilderte Situation (sich umarmende, küssende und mit einer Decke im Wald verschwindende Vierzehnjährige) auftritt:
- Eine Bibelfreizeit mit einem Pater als Leiter, der von der katholischen Sexuallehre völlig überzeugt ist, die unter anderem die Beherrschung des Sexualtriebes und Enthaltsamkeit bis zur Heirat fordert.
- Eine Ferienfreizeit mit einem Sozialpädagogen als Leiter, der von der politisch-emanzipatorischen Sexualpädagogik überzeugt ist, die unter anderem die Unterdrückung sexueller Bedürfnisse für schädlich hält und möglichst früh die Fähigkeit zum angstfreien Erleben sexueller Lust fördern will.
Diese beiden Leiter werden die Situation bereits verschieden wahrnehmen und interpretieren, dabei verschiedene Empfindungen und situative Gefühle haben, z. B.: Auf der einen Seite die Sicht einer Sünde und die Angst vor einer noch größeren Sünde, verbunden mit Sorge und Empörung; auf der anderen Seite die wohlwollend-zufriedene Beobachtung von Zärtlichkeiten. Entsprechend werden sie auch verschiedene Überlegungen anstellen, Handlungsimpulse verspüren und auch verschieden handeln: Der Eine wird möglicherweise eine Moralpredigt halten und strikte Verbote aussprechen, der Andere vielleicht fragen, ob sie Kondome brauchen ...
Das Beispiel soll zeigen, wie die in der Praxis auftauchenden Gefühle und die spontanen Reaktionsweisen von den subjektiven Vorstellungen und Überzeugungen abhängen; die beiden Leiter werden, wenn sie öfter Freizeiten leiten, auf dem Weg zum schnellen und intuitiven Handeln einen inhaltlich (zumindest in diesem Punkt) völlig verschiedenen pädagogischen Takt entwickeln. Damit ist aber auch der Weg gewiesen, wie der pädagogische Takt »zugleich ein wahrhaft gehorsamer Diener der Theorie« (Herbart 1982, S. 126) werden kann, also das Handeln so leitet, daß es dem gleicht, wozu man sich auch nach gründlicher wissenschaftlicher Reflexion entschließen würde: Diese Vorstellungen und Überzeugungen können durch eine theoretische Vorbereitung beeinflußt werden. Um noch einmal Herbart zu Wort kommen zu lassen: »Durch Überlegung, durch Nachdenken, Nachforschung, durch Wissenschaft soll der Erzieher vorbereiten - nicht ... seine künftigen Handlungen in einzelnen Fällen als vielmehr sich selbst, sein Gemüt, seinen Kopf und sein Herz zum richtigen Aufnehmen, Auffassen, Empfinden und Beurteilen der Erscheinungen, die seiner warten, und der Lage, in die er geraten wird« (ebda, S. 127).
Auf diese Weise ist es möglich, sich vor der pädagogischen Praxis auf sie vorzubereiten, indem man Wissen über die Phänomene der Erziehung, Kategorien zur Einordnung und Interpretation der Beobachtungen usw. erwirbt und mit begründeten Überzeugungen sein Werk beginnt. Die pädagogische Theorie dient dabei (inhaltlich gesehen) mit Beschreibungen, Erklärungen, Orientierungen usw., und die Beschäftigung mit der Wissenschaft übt (formal gesehen) zugleich die Fähigkeit zur kritischen Reflexion. Zwar entsteht der pädagogische Takt erst durch die Erfahrungen der Praxis selbst, aber welche Erfahrungen dies sein werden, hängt auch ab von den Vorstellungen und Überzeugungen, die mitgebracht werden: Diese bestimmen, wie schon erwähnt, die Wahrnehmung und Interpretation der konkreten Situation, die Ziele, die für richtig, gut, angemessen usw. gehalten werden, und die Handlungen, durch die in den konkreten Situationen die Ziele erreicht werden sollen. Deshalb kann durch das Studium der pädagogischen Theorie als allgemeine Vorbereitung auf die Praxis zwar nur indirekt, aber dennoch wirksam, die Ausbildung des Taktes beeinflußt werden. Die Unsicherheit des Anfangs wird im Prinzip bleiben, aber bei wiederholter Tätigkeit wird sie geringer werden und ein Takt sich ausbilden, der als Regent der Praxis zu einem schnellen und intuitiven Handeln führt, das (wenn auch nicht immer) dem entspricht, was man sich vorher auf der theoretischen Ebene überlegt hatte oder wozu man sich auch nach gründlicher Überlegung entscheiden würde. Und das ist auch der Weg, um einen bereits vorhandenen, früher erworbenen Takt zu ändern. Ändern sich nämlich die theoretischen Überzeugungen, wird sich in praktischen Situationen (über kurz oder lang) auch die Einschätzung, das gefühlsmäßige Empfinden und der innewohnende Handlungsimpuls ändern - und damit, bei Wiederholung und Übung, eben auch der pädagogische Takt.
Mit dieser allgemeinen Vorbereitung auf die pädagogische Praxis durch das Studium ist es jedoch nicht getan. Zum einen ist häufig auch eine besondere Vorbereitung auf eine bestimmte pädagogische Tätigkeit angebracht, daß man sich, um es wieder am Beispiel zu sagen, vorher Gedanken über die besonderen Probleme oder Aufgaben einer Freizeit macht, womöglich sogar bezogen auf die zu erwartenden Jugendlichen. Sofern diese Freizeit bestimmte Programmpunkte enthält, ist es häufig sogar notwendig oder sinnvoll, sich Konzepte für diese einzelnen Angebote zu überlegen. Zum anderen ist jedoch auch eine Nachbereitung nötig, eine Auswertung der Erfahrungen, die man in der Praxis gemacht hat, eine Überprüfung der Konzepte, die man vertritt und eventuell ihre Änderung auf Grund neuer Erfahrungen oder Erkenntnisse usw.(35)
Diese besondere Vorbereitung und Nachbereitung ist vor allem zu Beginn einer neuen Tätigkeit erforderlich, aber sie darf auch dann nicht (völlig) unterlassen werden, wenn man sich auf Grundlage wiederholter Tätigkeit und Erfahrung sicher fühlt: Zu leicht bilden sich sonst starre Gewohnheiten und schematische Handlungsmuster aus, die den konkreten Einzelsituationen und Einzelfällen nicht mehr gerecht werden. Da diese Gefahr groß ist, sollte man sich (durch regelmäßige Übung) bemühen, eine - zumindest kurze - Vor- und Nachbereitung zur Gewohnheit werden zu lassen.
Zwar gibt es, wie Langeveld sagte, nichts Praktischeres als eine gute pädagogische Theorie, aber ein Allheilmittel gegen die Schwierigkeiten der pädagogischen Praxis ist die Beschäftigung mit der pädagogischen Theorie natürlich nicht, und der pädagogische Takt ist nicht immer der 'Regent der Praxis'. Einige Probleme, die trotz oder sogar wegen der Beschäftigung mit Theorie auftreten können, werden deshalb abschließend kurz beschrieben.
1. Der Takt bildet sich, so wurde oben beschrieben, auf Grund wiederholter Erfahrung und Übung. Die Fähigkeit zum schnellen und intuitiven Handeln kommt damit nur in Situationen zum Tragen, die in strukturell ähnlicher Weise schon öfter auftraten. Die Praxis selbst bietet jedoch immer wieder Überraschungen, völlig neue Situationen ...
2. Die Entstehung des Taktes ist zwar indirekt beeinflußbar, aber nicht willentlich steuerbar, vor allem nicht die Zeitdauer, bis eine Erkenntnis oder ein Vorsatz sich sozusagen auch ins Gefühl eingeprägt hat und die schnellen Handlungsweisen bestimmt. Wie lange dies dauert und ob es überhaupt (vollständig) gelingt, hängt neben der individuellen Wesensart vor allem davon ab, wie stark verwurzelt die früheren Überzeugungen waren.
Beispiel: Angenommen, der oben geschilderte Pater wuchs in einem streng katholischen Elternhaus auf, war während der Schulzeit in einem bischöflichen Knabenseminar, wählte seinen Beruf aus innerer Berufung, studierte an einer katholischen Universität, wohnend in einem kirchlichen Studentenheim. Auch wenn er sich auf Grund von Überlegungen und/oder Erfahrungen von der päpstlichen Sicht der Sexualität abkehren und einer liberaleren Auffassung zuwenden sollte, wird er in seinen gefühlsmäßigen Empfindungen noch lange, vielleicht für immer, von seinen alten Überzeugungen geprägt sein. Er wird beim geschilderten Beispiel in seiner spontanen Interpretation wohl nicht mehr sofort eine Sünde sehen, aber ob er jemals dazu kommen wird, wirklich unbefangen zu sein, kein inneres Unbehagen mehr zu verspüren, wenn er mit vorehelichen oder außerehelichen sexuellen Handlungen konfrontiert ist?
3. Die schnellen Handlungen hängen nicht nur vom pädagogischen Takt ab, es gibt unmittelbar wirkende Faktoren, die situativ stärker sein können.
Beispiel: Den Leitern und Leiterinnnen einer Freizeit werden die verschiedenen Jugendlichen in unterschiedlichem Maße sympathisch oder unsympathisch sein. Haben sie (was hoffentlich nicht vorkommt!) noch niemals darüber nachgedacht, daß ihre je zufällige Sympathie und Antipathie kein Kriterium für ihre pädagogischen Handlungen und Maßnahmen sein darf, so werden sie beispielsweise auf die (wiederholte) Übertretung einer vereinbarten Regel mit unterschiedlicher Schärfe reagieren je nachdem, durch wen sie erfolgte. Haben sie jedoch darüber nachgedacht und sich vorgenommen, sich nicht von Sympathie/Antipathie leiten zu lassen, so ist die Wahrscheinlichkeit solch unterschiedlicher Reaktionen wesentlich geringer - aber sie sind vor allem dann nicht auszuschließen, wenn die Sympathie und Antipathie deutlich ausgeprägt ist. Und ebensowenig ist auszuschließen, auch wenn man es als falsch erkannt hat, daß die eigene Stimmung, etwa ein Ärger aus irgendwelchen sonstigen Gründen, sich Bahn bricht und zu einer scharfen Reaktion bei Anlässen führt, die ansonsten eher gleichgültig hingenommen werden.
4. Die theoretische Beschäftigung (vor allem mit möglichen Fehlern der Erziehung!) kann auch Gefahren in sich bergen, die Fähigkeit zum schnellen und intuitiven Handeln beeinträchtigen und statt dessen Unsicherheit und Zweifel vergrößern.
Ein gutes Beispiel dafür nennt Cheryl Benard (1987, S. 89), selbst Feministin und Mutter: Viele feministische Mütter, vor allem von Söhnen, die sich mit der Literatur über die Situation der Frau, ihrer Unterdrückung durch Männer, der Entstehung dieser Unterdrückung und Wege zur Emanzipation beschäftigt haben, leben so, als ob jeden Augenblick Sigmund Freud und Alice Miller und Margaret Mead und Alice Schwarzer am Fenster vorbeifliegen würden. Die mit diesem Bild beschriebene Verunsicherung am Problem der psychoanalytischen Sichtweise:
»Die Doktrin der 'giftigen' Mutterschaft, vermittelt von Freud und seinen Nachfolgern, lähmte Frauen ... in der Entwicklung spontaner, guter Beziehungen vor allem zu ihren Söhnen, indem sie die Stachel der bösen Unterstellung und des Selbstzweifels in jede mütterliche Handlung einschleuste. Du liebst Deinen Sohn? Vorsicht: sexuelle Katastrophe droht. Du willst ihm einen unabhängigen Menschen vorleben? Achtung: Neurosen. ...«
Benard zieht daraus eine Konsequenz, die in solchen und ähnlichen Fällen durchaus beherzigt werden sollte:
»Was folgt aus alledem? Gründlichere Ideologiekritik, Arbeitskreise, um Erfahrungen darüber auszutauschen? Bitte nicht. Ich schlage Müttern folgendes vor: Man stehe morgens auf, blicke prüfend in den Spiegel, und sage, 'Bin ich eine gute Mutter? Klar, warum nicht', und vergesse das ganze Thema dann bis zum folgenden Morgen« (Benard 1987, S. 105).
Gute Pädagogen und Pädagoginnen zeichnen sich nicht dadurch aus, daß sie in der konkreten pädagogischen Situation gründlich überlegen oder versuchen, sich an all das zu erinnern, was sie gelernt haben - dazu bleibt meist nicht die Zeit. Sie zeichnen sich vielmehr dadurch aus,
- daß sie in einer Vor- und Nachbereitung ihre theoretischen Kenntnisse nutzen, um über ihre Praxis zu reflektieren, Problemfälle zu analysieren und bewußte Entscheidungen zu treffen, und
- daß sie den richtigen Takt erworben haben, also in der Praxis schnell und intuitiv so handeln, daß es dem gleicht, wie sie auch nach ausführlicher wissenschaftlicher Reflexion handeln würden.
Dieser Takt kann nicht ohne pädagogische Praxis erworben werden, denn er bildet sich in der und durch die Praxis; aber er kann auch nicht ohne pädagogische Theorie erworben werden, indem diese auf der gedanklichen Ebene die Vorstellungen und Überzeugungen der Pädagogen und Pädagoginnen beeinflußt. Theorie ohne Erfahrung reicht nicht aus, aber bei Erfahrung ohne Theorie droht die Gefahr, daß aus der Erfahrung keine oder die falschen Schlüsse gezogen werden. Bei dieser Reflexion über die Praxis ist das in der Wissenschaft beheimatete diskursive Denken notwendig. In der unmittelbaren Praxis selbst ist dieses Denken kaum gefragt, sondern wird eher zum Hindernis für die schnellen Entschlüsse, die hier erforderlich sind.(36) Die wesentlichen Merkmale guter Pädagogen und Pädagoginnen sind deshalb, nochmals kurz gesagt: Die Fähigkeit zur diskursiven Reflexion über die Praxis und zur schnellen, intuitiven Handlung in der Praxis.
Wenn deshalb im Studium dauernd die Frage gestellt wird: Was nützt mir diese Theorie für die Praxis, und der Nutzen in einer unmittelbaren Anwendbarkeit gesucht wird, so führt diese Frage häufig zu einer Frustration. Die Antwort ist nämlich häufig oder fast immer: Die Theorie nützt in der Tat nicht unmittelbar! Das ist aber keine Kritik an der Theorie, sondern der Fehler liegt in einer falschen Erwartung, einer unzulässigen Übertragung des Theorie-Praxis-Verhältnisses im technischen Bereich auf die Pädagogik. Mittelbar nützt die Theorie und die Beschäftigung mit ihr viel mehr, als viele wahrhaben wollen oder vielleicht während des Studium wahrhaben können:(37) Sie beeinflußt die Ziele und die Einstellung, die Wahrnehmung und die Interpretation von Situationen, das gefühlsmäßige Empfinden in Situationen und darüber die spontanen Handlungsimpulse, sie befähigt, Erfahrungen zu überprüfen, Situationen zu analysieren, Handlungsalternativen zu entwerfen usw. Zwar gibt dieser Weg keine Garantie, neue Erkenntnisse immer oder sofort in die Praxis umsetzen zu können, zwar enthält er unplanbare Momente und birgt Gefahren in sich, - aber nur dadurch, so meine These, kann das pädagogische Wissen im Alltagsgeschäft der Erziehung auf Dauer praktisch werden.
Pädagogische Theorie wird dabei jedoch nur dann praktisch, wenn sie die eigenen Vorstellungen und Überzeugungen beeinflußt oder bestimmt: Es genügt nicht, sie nur zur Kenntnis zu nehmen. Daraus ergeben sich Konsequenzen für das wissenschaftliche Studium der Pädagogik ...
* * *
Der Beginn des Studiums bedeutet den Schritt vom überwiegend angeleiteten Lernen an der Schule zum eigenverantwortlichen Studieren an der Universität. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Schule und der Universität ist bereits im Grundgesetz verankert: »Das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates« heißt es im Art. 7 Abs. 1 GG, während der Art. 5 Abs. 3 GG festlegt: »Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.«
Dieser Unterschied wird sofort deutlich, wenn man die jeweiligen Lehrinhalte vergleicht: Die Inhalte eines Faches an der Schule werden weitgehend durch die Lehrpläne festgelegt, die von den Kultusministerien erlassen werden. Diese verbindlichen Vorgaben lassen den einzelnen Lehrern und Lehrerinnen relativ wenig individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Lehrpläne sind zudem so gestaltet, daß der Unterricht in einem Jahr in der Regel auf dem aufbaut, was im Jahr zuvor gelernt wurde. Dadurch wird eine weitgehende Einheitlichkeit in den Inhalten und der Abfolge der Unterrichtsthemen erreicht. Zwar sind auch die Lehrenden an der Hochschule bestimmten Verpflichtungen unterworfen, aber sie haben viel mehr Freiheiten als die Lehrenden an den Schulen. Studienpläne, die in Ihrem Aufbau den schulischen Lehrplänen gleichen, beruhen an der Universität wesentlich auf einer gemeinsamen Übereinkunft der Lehrenden; in der Sache begründet gibt es solche Studienpläne zum Beispiel in den naturwissenschaftlichen oder technischen Fächern. In den sozialwissenschaftlichen und philosophischen Fachbereichen bzw. Fakultäten sind sie dagegen nur selten anzutreffen und auch in der Pädagogik eher die Ausnahme. Der Grund: Bei den Lehrenden im Fach Pädagogik bestehen große Unterschiede im Verständnis der Pädagogik als Wissenschaft, in der Bestimmung ihrer Aufgaben, in der Definition der Grundbegriffe usw., so daß von einer einheitlichen Pädagogik kaum die Rede sein kann (vgl. Brinkmann/Renner1982) - und damit auch nicht von einer einheitlichen Lehre.(38) Entsprechend sind die von einem Institut erstellten und den Studierenden mehr oder weniger eindringlich empfohlenen Studienpläne oft nur eine eher formale Einigung auf bestimmte Themen ohne genaue Festlegung der jeweiligen Inhalte. Zu dieser im Vergleich zur Schule relativ geringen Einheitlichkeit der Lehre kommt ein weiterer Unterschied: Die Lehrveranstaltungen in aufeinanderfolgenden Semestern bauen nur teilweise in einer ähnlichen Weise aufeinander auf wie der Unterricht an der Schule in aufeinanderfolgenden Jahrgängen.
Der oben benannte Unterschied zwischen der Schule und der Universität macht sich auch im Studium selbst geltend. Zwar wird häufig eine zunehmende Verschulung der Universität beklagt, aber ein Vergleich mit der Schule zeigt doch, daß gerade im Bereich der sozialwissenschaftlichen und philosophischen Fakultäten bzw. Fachbereiche die Pflichten wesentlich geringer und entsprechend die Wahlmöglichkeiten wesentlich größer sind. Als Beispiel kann der Magisterstudiengang an den Philosophischen Fakultäten der Universität Erlangen dienen: Er umfaßt eine weitgehend frei wählbare Kombination von drei Fächern; die Zwischen- und die Magisterprüfungsordnung schreiben insgesamt die erfolgreiche Teilnahme an acht Proseminaren und vier Hauptseminaren vor; die Abschlußprüfung muß am Ende des dreizehnten Semesters abgelegt sein. Der Pflichtanteil im Studium ist also wahrlich gering, die Freiheit groß.
Die in alledem zum Ausdruck kommende akademische Freiheit hat viele Vorteile für die Studierenden: Das Angebot ist vielfältig, es bestehen mehr oder weniger große Möglichkeiten der Wahl, man kann sich interessante Themen und/oder die Lehrenden aussuchen, bei denen man glaubt, mehr zu lernen als von anderen usw.
Die akademische Freiheit kann jedoch auch große Probleme mit sich bringen, vor allem zu Beginn des Studiums. Von den Studierenden wird eine wesentlich größere Selbständigkeit verlangt als von den Schülern: Sie können sich nicht darauf verlassen, daß das, was für den Studienerfolg notwendig ist, schlicht und einfach vorgegeben wird. Sie müssen, und darin kommt das ganz praktisch zum Ausdruck, sich einen individuellen Stundenplan zusammenstellen. Das ist nicht nur eine Frage geschickter Zeiteinteilung, sondern erfordert auch inhaltliche Überlegungen, nach Möglichkeit den längerfristigen Entwurf eines eigenen, individuellen Studienplanes. Wenn, wie im obigen Beispiel von Erlangen, durch die Prüfungsordnungen relativ wenig Pflichtveranstaltungen vorgeschrieben sind, genügt es bei weitem nicht, nur sie zu besuchen. Das in einer Prüfung erwartete Wissen umfaßt mehr als den Stoff der Pflichtveranstaltungen. Nur die formale Pflicht zu erfüllen ist deshalb fast immer zu wenig, notwendig ist ein zusätzliches freiwilliges Studium, der Besuch weiterer Seminare und Vorlesungen sowie die Lektüre der Fachliteratur. Die Erfahrung zeigt, daß dabei zwei Probleme auftauchen können. Erstens: Wenn der äußere Druck fehlt, fällt das Studieren oft recht schwer, es kommt zu Arbeitsschwierigkeiten oder Motivationsproblemen; auch ohne drängende Klausur-, Referat- oder Prüfungstermine kontinuierlich zu arbeiten ist ein oft schmerzhafter Lernprozeß. Zweitens: Diejenigen, die (ziemlich) kontinuierlich arbeiten und Lehrveranstaltungen besuchen, wählen nicht selten vorzugsweise die Themen und Veranstaltungen, die ihren Interessen entsprechen. Das ist gut so und ein Teil der akademischen Freiheit. Aber auch hier droht eine Gefahr, vor allem wenn die Interessen nicht sehr weit gestreut sind: Einige Gebiete werden zwar vertieft studiert, aber die bei der Prüfung erforderliche thematische Breite fehlt. Vor der Prüfung, wenn der Themenkatalog festgelegt wird, stellen dann (zu) viele erschreckt fest, daß sie sich in manche Gebiete völlig neu einarbeiten müssen statt auf Studienleistungen zurückgreifen zu können.
Der Beginn des Studiums bedeutet jedoch nicht nur den Schritt vom überwiegend angeleiteten schulischen Lernen zum eigenverantwortlichen Studium samt den damit einhergehenden Anforderungen und Schwierigkeiten. Auch die oben schon angesprochene Theorienvielfalt in der Pädagogik führt oft zu Problemen, die ein Vergleich mit dem Studium naturwissenschaftlicher Fächer verdeutlichen kann.
Zunächst zum Unterschied der Wissenschaften:
In den Naturwissenschaften ist der Bestand an gesichertem Wissen(39) relativ hoch. Physik, Chemie usw. verfügen über eine große Anzahl von Erkenntnissen und Aussagen über ihre Gegenstände, deren Gültigkeit in der Fachwelt unbestritten ist. Gemessen an diesem Bestand ist die Zahl alternativer Theorien(40) eher gering, auch wenn diese naturgemäß im Brennpunkt des Interesses stehen. Die Existenz alternativer Theorien und Erklärungsversuche wird dabei in den Naturwissenschaften als ein zeitlich befristeter Mangel angesehen, den es durch weitere Forschungen zu beseitigen gilt.
In Pädagogik wie in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften allgemein ist die Sachlage völlig anders: Der Bestandteil an gesichertem, von den Fachwissenschaftlern ohne Zweifel und Streit akzeptiertem Wissen ist hier vergleichsweise gering und die Zahl alternativer Theorien entsprechend hoch. Zu fast jedem Gegenstand gibt es in der Pädagogik unterschiedliche Theorien, Ansätze, Positionen: Schon der Charakter der Wissenschaft als solcher (hermeneutisch? kritisch? phänomenologisch? usw.) ist umstritten, ebenso die Festlegung der Grundbegriffe und viele Einzelfragen. Auch wenn diese Situation manchmal beklagt und ihre Überwindung gewünscht wird, ist sie in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften der als Faktum akzeptierte Normalfall.
Diesen Unterschied zwischen den Naturwissenschaften und den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften kann eine kleines Beispiel verdeutlichen: Man vergleiche einmal Lehrbücher der Physik oder der Chemie mit denen der Pädagogik. Kaum übertrieben könnte man sagen, daß die einen die systematische Darstellung gesicherten Wissens beinhalten, während die anderen über unterschiedliche Theorien und alternative Erklärungsansätze informieren. Analoge Titel wie »Hauptströmungen der Erziehungswissenschaft« oder »Modelle pädagogischer Theoriebildung« sind in der Physik oder Chemie kaum vorstellbar.
Entsprechend ergeben sich auch zum Teil unterschiedliche Anforderungen im Studium: In den Naturwissenschaften müssen die Studierenden zunächst und vor allem Wissen erwerben, sich die vorhandenen Kenntnisse aneignen; ihre Haupttätigkeit im Studium ist das eher rezeptive Lernen. Produktives, eigenständiges Denken und Urteilsvermögen sind erst dann gefordert, wenn es gilt, die Fälle der Realität unter das erworbene theoretische Wissen zu subsumieren und zu entscheiden, welche Theorie im konkreten Einzelfall die Erklärung liefern kann. Diesem Zweck dienen die Übungsbeispiele im Studium oder die gesonderten praktischen Ausbildungsphasen, und es gibt dabei in der Regel über die Frage, welche Theorie das jeweils ist, eine objektiv richtige Antwort. Jede andere Antwort gilt ebenso als Fehler, wie wenn die Inhalte einer Theorie unvollständig oder unzutreffend referiert werden.
Wenn die Studierenden der Naturwissenschaften das jeweilige Fachwissen sowie die Fähigkeit erworben haben, vorgefundene Einzelfälle richtig unter die zuständigen Theorien zu subsumieren, dann ist das Ausbildungsziel erreicht. Ausgerüstet mit diesem Wissen und dieser Fähigkeit sind sie im Prinzip den fachlichen Anforderungen der Berufspraxis gewachsen. Wer zum Beispiel die Lehrbücher der Chemie gründlich kennt, weiß, wie Rückstände von Pestiziden in Lebensmitteln gefunden werden können, welche Analysen vorzunehmen und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind.
Auch in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften müssen die Studierenden sich zunächst den vorhandenen Bestand an Theorien aneignen und sie reproduzieren können; und sie müssen sich ebenfalls die Fähigkeit aneignen, konkrete Fälle der Realität der entsprechenden Theorie zuzuordnen, um sie mit Hilfe der Theorie zu interpretieren oder zu erklären. Unvollständige oder ungenaue Wiedergabe von Theorien gelten auch hier ebenso als Fehler wie die unzutreffende Zuordnung eines konkreten Falles zur entsprechenden Theorie. Die Differenz zu den Naturwissenschaften liegt jedoch darin, daß hier oft keine eindeutige Zuordnung möglich ist: Den unstrittig falschen Möglichkeiten steht nicht eine richtige theoretische Lösung gegenüber, sondern mehrere Theorien, die gleichzeitig beanspruchen, die Erklärung zu liefern!
Und wer die Lehrbücher der Pädagogik ebensogut kennt wie die Studierenden der Naturwissenschaften ihre Lehrbücher, ist dadurch im Unterschied zu diesen noch nicht für die fachlichen Aufgaben der Praxis gerüstet. Die hängt einerseits mit dem Charakter der pädagogischen Theorien zusammen: Sie beinhalten, wie schon beschrieben, keine Kausalgesetze, aus denen direkte Handlungsanweisungen ableitbar sind. Andererseits genügt es angesichts der vielen alternativen Theorien in der Pädagogik nicht, sie nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern es sind Beurteilungen nötig, welchen man zustimmt und welchen nicht. Wird dies unterlassen, kann die umfassende Kenntnis der verschiedenen Theorien sogar zum Hindernis für die Handlungsfähigkeit in praktischen pädagogischen Situationen werden.
Um dieses Problem am schon geschilderten Beispiel des Ferienlagers zu verdeutlichen: Nehmen wir diesmal an, die Leiter und die Leiterinnen haben sich im Studium ausführlich mit sexualpädagogischen Fragestellungen beschäftigt und kennen die verschiedenen Theorien sehr genau. Nun beobachten sie die bereits beschriebene Situation: Zwei sich umarmende, küssende und mit einer Decke im Wald verschwindende Vierzehnjährige. Wie ist die Situation zu interpretieren, was werden die beiden möglicherweise oder wahrscheinlich tun, wie ist das zu bewerten und wie sollen die Leiter und Leiterinnen sich entscheiden?
Nun gibt es beispielsweise in der Literatur die Kontroverse, ob sexuelle Motivation eher durch das 'Triebmodell' oder eher durch das 'Lustsuche-Modell' erklärbar ist (Schmidt 1988). Das Triebmodell geht davon aus, daß sexuelle Energie oder sexuelle Bedürfnisse auf Grund innerer physiologischer Prozesse entstehen, sich aufstauen und zur Entladung drängen. Wird diesem Drang nachgegeben, können sie, wenn der Triebstau groß war, eine Dynamik haben oder gewinnen, die willentlich nur schwer oder gar nicht mehr beherrschbar ist. Wenn man hingegen wie im Lustsuche-Modell »die Triebhaftigkeit der Sexualität verneint und ihr damit den Charakter des ungestümen, unbändigen Naturtriebes abspricht, wird Sexualität eine Bereitschaft oder Möglichkeit zur Lust und ihr autochtoner Erlebniswert damit zu etwas Harmlos-Genußvollen« (Schmidt 1988, S. 305), sie wird »friedlich und hedonistisch« (ebda S. 316). Nur wenn die Erfüllung sexueller Wünsche und Bedürfnisse durch eine rigide Sexualmoral dauerhaft unterdrückt wird, können sie die bedrohliche Dynamik gewinnen, die im Triebmodell als natürliche Eigenart der Sexualität beschrieben wird.
Außerdem gibt es in der sexualpädagogischen Literatur die verschiedensten Positionen zu den Aufgaben der Sexualerziehung, von der Forderung, möglichst früh die Beherrschung des Sexualtriebes einzuüben, um nicht vom Naturtrieb überwältigt zu werden, sondern autonome, ethisch begründete Entscheidungen treffen zu können, bis zur Forderung, daß den Jugendlichen ein repressionsfreier Raum geboten werden muß, in dem sie ohne Angst sexuelle Erfahrungen sammeln können, da die Unterdrückung der Sexualität zur Ich-Schwäche und zu einem autoritären Charakter führe.
Viele solcher und ähnlicher Erklärungen, Theorien und Forderungen werden den Leitern und Leiterinnen durch den Kopf gehen, und das Problem liegt darin, daß aus ihnen höchst unterschiedliche Interpretationen der Situation und Handlungskonsequenzen folgen: Nach dem Triebmodell besteht die Möglichkeit, daß ein aufgestauter sexueller Drang, wird ihm erst einmal nachgegeben, nicht mehr beherrschbar sein wird - also sofort einschreiten, verhindern und verbieten? Aber nach dem Lustsuche-Modell erhalten gerade durch die Unterdrückung eigentlich friedlich-harmlose Wünsche eine gefährliche Eigendynamik. Und was nach der einen sexualpädagogischen Konzeption zur Ich-Stärke führt, erzeugt nach der anderen eine Ich-Schwäche. Welcher Interpretation soll man denn nun folgen, wie soll man handeln?
Das Beispiel zeigt: Die Kenntnis vieler (verschiedener) Theorien kann für das pädagogische Handeln zum Hindernis werden statt Hilfe zu bieten. Wenn das im Studium erworbene Wissen für die pädagogische Praxis hilfreich sein soll, dann müssen im Falle alternativer Theorien auf der theoretischen Ebene Einschätzungen vorgenommen und Entscheidungen getroffen werden: eine Beurteilung dieser Theorien danach, welchen man zustimmt und welchen nicht. Um Mißverständnissen vorzubeugen: Hiermit wird nicht etwa verlangt, sich auf eine einzige Theorie festzulegen und die anderen dann gar nicht mehr zu beachten, denn dies würde zu Einseitigkeit und Dogmatismus führen. Die Vielfalt der Theorien hat ja den Vorteil, daß Probleme unter vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden und damit die eine Theorie auf Phänomene aufmerksam machen kann, die in den anderen übersehen werden. Um diese vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten und Deutungen zu nutzen, muß man sich vor vorschnellen oder globalen Urteilen schützen und sich offenhalten, Theorien auch selektiv zu nutzen, da man oft auch aus Theorien, die man als ganze gesehen nicht akzeptiert, wichtige Einzelerkenntnisse entnehmen kann. Es kommt also darauf an, einen Weg zu finden zwischen dogmatischer Einseitigkeit und vielfältigen Kenntnissen ohne eigene Position.(41)
Eine eigene Position gewinnt man nur, wenn man selbst Theorien kritisch prüft und Einschätzungen vornimmt; man kann sie nicht einfach von den Lehrbüchern oder den Lehrenden übernehmen, denn diese sind ja immer schon Partei im Meinungsstreit. Solche eigenen Entscheidungen sind oft schwierig, vor allem zu Beginn des Studiums, wenn noch kaum inhaltliche Voraussetzungen für eine sachgerechte Beurteilung vorhanden sind und man zudem häufig nicht weiß, nach welchen Gesichtspunkten überhaupt Beurteilungen erfolgen können oder sollen.
Dazu kommt (meist) noch ein psychologischer Grund. In der Universität stehen sich gegenüber: Auf der einen Seite die Studierenden, die sich einige wenige Jahre lang mit Wissenschaft beschäftigen, dabei häufig (z.B. im Magisterstudiengang) ihre Zeit auf verschiedene Fächer aufteilen müssen und vor allem zu Beginn des Studiums oft unsicher und orientierunglos sind. Auf der anderen Seite die Lehrenden, die nach eigenem Studium und der Promotion schon jahre- oder jahrzehntelang hauptberuflich in einem Fach (meist sogar spezialisiert auf bestimmte Gebiete) wissenschaftlich tätig sind. Sie haben sich in diesen Jahren ein unvergleichlich größeres Wissen angeeignet, sind geübt im wissenschaftlichen Denken.
Die (fast notwendige) Folge: Vielen Studierenden erscheinen die Lehrenden als übermächtige Autoritäten, gegenüber denen sie sich klein und unwissend fühlen. Sie haben oft schon Angst, Fragen zu stellen, weil sie dadurch eigene Denkfehler oder Wissenslücken offenbaren könnten. Leider wird diese Angst durch diejenigen Lehrenden noch verstärkt, die sich in Vorlesungen oder Seminaren über die Unwissenheit der Studierenden beklagen und kritisieren, daß ihnen als selbstverständlich Erscheinendes nicht vorausgesetzt werden kann. Manchmal haben sie ja damit recht, aber meist ist es so, daß sie sich nicht mehr auf den Stand der Studierenden zurückversetzen können oder wollen und die o.g. Differenz schlicht ignorieren.(42)
Angesichts dieser Situation akzeptieren viele Studierende die Lehrenden (zunächst) als nicht hinterfragbare Autoritäten und nehmen sich vor, erst einmal nur (rezeptiv) zu lernen, bis man später sich zu eigener Stellungnahme oder gar Widerspruch befähigt fühlt. Jedoch: Die Differenz zu den Lehrenden wird im Laufe des Studiums zwar (hoffentlich) geringer, aber sie bleibt (meist) im Prinzip erhalten, so daß sich die Ausgangssituation nur quantitativ ändert und viele ihre Zurückhaltung niemals verlieren. Außerdem: Wenn das reine Zuhören und Aufnehmen zur Gewohnheit geworden ist, fällt es schwer, sie wieder abzubauen. Viele Studierende, die in den Proseminaren niemals von sich aus das Wort ergreifen, schweigen auch in den Seminaren des Haupstudiums. Je früher man deshalb im Studium die Angst überwindet, im Seminar Fragen zu stellen, wenn man etwas nicht verstanden hat, etwas wissen will, oder einen Diskussionsbeitrag zu leisten, desto besser; später wird es meist nicht leichter, sondern eher noch schwieriger, diese Angst zu überwinden!
Durch die eben beschriebene Haltung kann noch ein weiteres Problem auftreten: Die verschiedenen Lehrenden auch eines Faches argumentieren oft nicht einheitlich, sondern vertreten unterschiedliche oder gar gegensätzliche Positionen zu bestimmten Problemen. Damit entsteht für die Studierenden der Konflikt: Welcher der Autoritäten soll man denn nun glauben? Sie können ja nicht alle zugleich recht haben ...
Es ist angesichts der Theorienvielfalt also kein Ausweg, den Lehrenden autoritätsgläubig folgen zu wollen. Die Anstrengung muß vielmehr darauf gerichtet werden, so schwer es auch ist, sich selbst möglichst früh um eigene Gedanken, inhaltliche Stellungnahmen und begründete Entscheidungen zu bemühen. Natürlich kann man dabei irren, wird oft genug irren und sich später korrigieren müssen. Wer jedoch aus Angst vor einer falschen Entscheidung auf Entscheidungen ganz verzichtet, trifft niemals eine richtige Entscheidung!
Es geht dabei, wie gesagt, um Entscheidungen, die begründet sind und sich in Diskussionen bewähren müssen. Auch hier gibt es Fehlformen im Studium: Manche beteiligen sich rege am Seminargespräch, verkünden dabei jedoch nur die eigene Ansicht ohne Argumente. Sie glauben, auf Grund der Vielfalt in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sei es erlaubt, zu allem und jedem einfach seine Meinung zu sagen, ohne sich mit der Sache selbst gründlich befassen zu müssen. Diskussionen in Seminaren gleichen dann fast den vielen Talk-Shows im Fernsehen, in denen nicht argumentiert und den Anderen nicht zugehört, sondern vor allem Selbstdarstellung betrieben wird. Mit wissenschaftlicher Diskussion hat das jedoch nichts zu tun: Gespräche und Diskussionen in der Wissenschaft sollen Unklarheiten beseitigen, Problemstellungen entwickeln, Thesen und Theorien einer Prüfung unterziehen usw. Allgemein gesprochen: Wissenschaftliche Diskussionen und Gespräche dienen der Erkenntnis, sie können dabei eine gemeinsame Anstrengung sein, Klarheit zu finden, etwas Neues zu entdecken, oder auch ein Streitgespräch, wo die Partner versuchen, einander zu kritisieren und zu überzeugen.
Im geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich muß dabei wesentlich mehr diskutiert werden als im naturwissenschaftlichen Bereich, wo man viele Sachverhalte empirisch oder experimentell eindeutig klären kann und Begriffe eindeutig definiert sind. Wenn die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften deshalb manchmal als Diskussionswissenschaften bezeichnet werden, so wird damit ein wichtiges Merkmal beschrieben und der oft abwertende Unterton verkennt, daß Diskussionen immer dann notwendig sind, wenn eine Sache empirisch nicht oder noch nicht entschieden werden kann. Und viele Fragen in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sind nun mal empirisch nicht entscheidbar; statt einer Prüfung durch Experimente bedarf es deshalb der kritischen Diskussion, in der Annahmen, Thesen und Argumente sich Fragen oder Einwänden stellen und sich bewähren müssen.
Ich fasse zusammen: Das Studium der Pädagogik ist unvollständig, wenn es sich allein auf die Rezeption der vorhandenen Theorienvielfalt beschränkt. Es muß auch eine produktive, selbständig urteilende Reflexion einschließen, damit die Studierenden entscheiden können, welchen der unterschiedlichen Theorien und Erklärungsansätze sie zustimmen und welche sie ablehnen. Wenn sie als Ergebnis solcher Entscheidungen, die auf Überlegungen und Prüfungen beruhen, eine eigene Position gewinnen, so handelt es sich dabei um eine argumentativ begründete, die in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Theorien gewonnen wurde. Verzichten sie auf solche Entscheidungen und beschränken sie ihr Studium auf eine urteilslose Anhäufung von Kenntnissen, so können sie zwar in der Regel durchaus Prüfungen bestehen, gewinnen aber durch das Studium wenig oder nichts für die spätere praktische Tätigkeit.
Im Hinblick auf die spätere Berufstätigkeit kommt beim Pädagogikstudium ein weiterer Gesichtspunkt hinzu: Zur Kompetenz im pädagogischen Bereich zählt häufig auch ein gegenständliches, materiales Wissen, und zwar immer dann, wenn Pädagogen und Pädagoginnen in irgendeiner Form der Lehre tätig werden.
Das Entwicklungstempo moderner Gesellschaften ist so schnell geworden, daß der Grundbestand an Kenntnissen und Fähigkeiten, der in Schule und Ausbildung erworben wurde, laufend ergänzt, erweitert und korrigiert werden muß. In vielen, nicht nur technischen Berufen ist eine ständige Lernbereitschaft gefordert, um den neuen Aufgaben gewachsen zu sein. Ganze Berufsfelder werden überflüssig, so daß von den bisher darin Tätigen völlig neue Qualifikationen erworben werden müssen, wenn sie weiterhin Arbeit finden wollen.(43)
Das bedeutet jedoch umgekehrt, daß der Umfang notwendiger Vermittlungstätigkeiten, also pädagogischer Aufgaben wächst. Vermitteln kann die verlangten Fähigkeiten und Kenntnisse jedoch nur, wer sie selbst beherrscht; rein pädagogische Qualifikationen genügen nicht - eigentlich eine banale Aussage: Um Anderen eine Fremdsprache zu lehren, muß man sie selbst beherrschen usw. Aus ihr ergibt sich jedoch eine Konsequenz für das Studium: Ohne sich im Studium auch solche Qualifikationen (zumindest in Grundzügen) anzueignen, bleiben diese möglichen Berufsfelder den Pädagogen und Pädagoginnen verschlossen und weiterhin den Fachleuten anderer Disziplinen überlassen, denen es umgekehrt häufig an pädagogischen Qualifikationen mangelt. Im Fach Pädagogik selbst können jedoch diese inhaltlichen Qualifikationen in der Regel nicht erworben werden, sondern nur im Studium anderer, materialer Fächer.
In diesem Kontext erweist sich der Magisterstudiengang als eine große Chance: Im Unterschied zum Diplomstudiengang ermöglicht er vielfältige Fächerkombinationen. Diese Möglichkeit, gleichgültig ob man dabei die Pädagogik als Hauptfach oder als Nebenfach mit einem materialen Fach kombiniert, sollte gerade zu Beginn des Studiums reiflich überlegt werden.
1. Ich verwende den Begriff Pädagogik hier (und in der Regel auch später im Text) gleichbedeutend mit dem Begriff Erziehungswissenschaft. Der Begriff Pädagogik ist jedoch doppeldeutig, denn oft wird damit auch die Erziehungspraxis bezeichnet.
2. Wenn nicht die Sache selbst, sondern ein vorgängiger Wunsch nach einem bestimmten Ergebnis das Denken leitet, schleichen sich leicht Fehler ein oder das Denken wird ideologisch. Vgl. dazu das Kapitel über die Beurteilung wissenschaftlicher Aussagen, vor allem das Beispiel der Schädelmessungen im letzten Jahrhundert.
3. Selbst noch die Behauptung, daß eine zutreffende Erkenntnis der außerhalb des Denkens existierenden Welt nicht möglich oder objektive Wahrheit nicht erreichbar sei, hat den Anspruch, eine objektive, allgemeingültige Wahrheit über das menschliche Denken zu verkünden ....
4. Häufig wird der Begriff (kausale) Erklärung für diesen Erklärungstyp reserviert, 'Verstehen' und 'Erklären' bilden dann Gegenbegriffe. Die von mir im Anschluß an Derbolav (1987) bevorzugte weite Fassung des Begriffes beruht darauf, daß für mich z.B. das Verstehen einer zunächst unbegreiflichen Handlungsweise durch das Erkennen ihres Zweckes zugleich eine Erklärung dieser Handlungsweise beinhaltet.
5. Dieser Unterscheidung entspricht traditionellerweise auch eine Abgrenzung der Gegenstandsbereiche: Die Naturwissenschaft kümmert sich um den Bereich der Natur; die Geisteswissenschaften um den Bereich, in denen dieser Sinn existiert, also um gesellschaftliche und kulturelle Phänomene (weswegen sie oft auch als 'Kulturwissenschaften' oder 'Gesellschaftswissenschaften' bezeichnet werden). Diese (hier vereinfacht geschilderte) Aufteilung der Wissenschaften gemäß ihres Gegenstandes und der Art seiner Erforschung blieb jedoch nicht ohne Widerspruch: Neben den Versuchen, den Bereich naturwissenschaftlichen Vorgehens auch auf die traditionellen Gegenstände der Geisteswissenschaften auszudehnen, gibt es in jüngster Zeit ebenso die gegenläufige Tendenz, auch bei der Erforschung der Natur nach einem Sinn zu suchen.
6. Exaktheit darf nicht gleichgesetzt werden mit Meßbarkeit: Es hängt von den jeweiligen Gegenständen ab, die beschrieben und erklärt werden sollen, ob eine Quantifizierung möglich ist oder nicht.
7. Auch wenn diese Kriterien nicht erfüllt werden, können Aussagen informativ und anregend sein, vielleicht sogar der Forschung neue Wege weisen. Aber: Es sind dann nicht überprüfbare Behauptungen, die deshalb nicht beanspruchen können, daß ihnen allgemein zugestimmt wird.
8. Auch wenn man der Theorie von Jaynes über den Ursprung des Bewußtseins nicht folgen mag, bietet er eine hervorragende Analyse der Merkmale des Bewußtseins.
9. »Methode« ist dabei für Litt keineswegs ein »'Werkzeug', ein 'Instrument', das das Subjekt anwendet, um dem Gegenstand beizukommen« (ebda S. 54), sondern die Selbstdisziplinierung des Denkens auf die Sache hin (ebda S. 55).
10. Meistens fallen einem dabei andere Namen oder Begriffe ein, von denen man jedoch sogleich weiß, daß sie nicht die gesuchten sind. Genau betrachtet ist das eine erstaunliche Leistung: Obwohl man den gesuchten Namen oder Begriff nicht positiv benennen kann, weiß man, daß diese Einfälle falsch sind!
11. Vgl. Jaynes 1988, S. 58. Dies wird übrigens auch von der modernen Hirnforschung bestätigt; vgl. Gazzaniga 1988.
12. Vgl. dazu auch den Anhang!
13. Kurz zur Erinnerung: Die Kriterien für eine Kontrolle sind vor allem Eindeutigkeit und Exaktheit, Widerspruchsfreiheit, argumentative Rechtfertigung und Begründung. - Auch wenn in diesem Abschnitt von schriftlichen Texten die Rede ist, gelten diese Maßstäbe natürlich auch für wissenschaftliche Aussagen, die mündlich vorgetragen werden.
14. Im Folgenden rede ich zwar vorwiegend von den Beweisen und seinen Elementen; die Aussagen gelten jedoch auch für die Schlüsse, da beide sich logisch gesehen ja nur durch die Abfolge von Voraussetzungen und Ergebnissen unterscheiden. Vgl. dazu die entsprechenden Ausführungen im Anhang.
15. Burt ist zwar der wohl gravierendste, aber leider nicht der einzige Fall, wo betrogen und getäuscht wurde; weitere Fälle werden beschrieben von Broad/Wade (1984).
16. Ich verstehe also Ideologie nicht im neutralen Sinne als Weltanschauung, sondern als ein Aussagensystem, das wegen einer Weltanschauung wissenschaftliche Fehler enthält!
17. Zu den neueren Diskussionen über die Intelligenz und damit verfolgte ideologische Absichten vgl. die Quellentexte bei Quitzow (1990). Gould behauptet übrigens einen Zusammenhang zwischen den ideologischen Absichten der Schädelmessung und der modernen Intelligenzmessung: »Was die Kraniometrie für das neunzehnte Jahrhundert war, ist der Intelligenztest für das zwanzigste geworden« (ebda S. 20).
18. Vgl. dazu auch die Beispiele in Bundesarbeitsgemeinschaft (1986) und Stober (1990).
19. Zur folgenden Argumentation vgl. Litt 1967.
20. Als technisches Handeln soll hier ein Handeln bezeichnet werden, das mit Stoffen, Gegenständen oder Materialien umgeht, sie herstellt, bearbeitet usw.
»Technologie: Die Lehre von der Umwandlung von Rohstoffen in Fertigprodukte«; »technologisch: verfahrenstechnisch« (Duden).
21. Meine Formulierungen in dem Beispiel sind, an der naturwissenschaftlich-technischen Begrifflichkeit gemessen, nicht präzise, eventuell sogar fehlerhaft. Aber es kommt hier, wie auch in den folgenden Ausführungen, nur auf das Prinzip an, das, hoffe ich, dennoch deutlich wird!
22. Die These kann hier nur kurz erläutert, nicht ausführlich begründet oder gegen Einwände verteidigt werden. Zu ihrer Begründung und Verteidigung vgl. Leonhard 1989.
23. Vorrangig, denn es gibt ja auch die Erwachsenenpädagogik und die Altenpädagogik ...
24. Zur modernen Entwicklungspsychologie vgl. Asendorpf 1988.
25. Vgl. die sog. paradoxe Intervention in einer Therapie: Ein Klient oder eine Klientin wird zu etwas aufgefordert in der Hoffnung oder Erwartung, daß er bzw. sie genau das Gegenteil tut!
26. Außerdem, nur am Rande bemerkt: Wenn man von einer Determiniertheit der Kinder durch wirkende Einflüsse ausgeht statt von der Möglichkeit eigener Entschlüsse und Entscheidungen, dann muß man dies konsequenterweise auch für die Eltern selbst annehmen. Wie sollen sie sich dann aber für bestimmte Erziehungsziele entscheiden können?
27. Vgl. dazu auch das Stichwort Theorie-Praxis in Lenzen 1989.
28. Die Bedeutung des jeweils vorhandenen Wissens zeigt sich z.B. auch an einem Tatbestand, der in letzter Zeit immer mehr diskutiert wird: Wer nicht weiß, daß Schlafstörungen, Alpträume, Konzentrationsstörungen, Appetitlosigkeit, Nachlassen in schulischen Leistungen bei Kindern auf sexuellen Mißbrauch hindeuten können, wird beim Beobachten dieser Symptome niemals diese Möglichkeit als Erklärung in Betracht ziehen ...
29. »Diskursiv: Von einer Vorstellung zur anderen mit logischer Notwendigkeit fortschreitend« (Duden).
30. Zur Vermeidung von Mißverständnissen: Die folgenden Ausführungen sind eine analytische Rekonstruktion von Vorgängen, die in der Erlebenswirklichkeit zwar enthalten sind, aber eher selten als solche deutlich bewußt werden.
31. »Habitualisierung: Bildung von Gewohnheiten, die dann automatisiert sind« (Duden).
32. Ich übernehme übrigens nicht nur den Begriff des pädagogischen Taktes aus Herbarts erster Vorlesungsstunde von 1802, sondern der Gedankengang in diesem Kapitel beruht in wesentlichen Teilen auf Einsichten, die ich durch die Lektüre dieser Vorlesung gewonnen habe (vgl. Herbart 1982, S. 121 ff)!
33. »Intuition: Das unmittelbare, nicht diskursive, nicht auf Reflexion beruhende Erkennen, Erfassenen einer Sachverhalts oder eines komplizierten Vorgangs«; »intuitiv: Auf Intuition beruhend; Ggs. diskursiv« (Duden). Ich verwende »intuitiv« in dieser Bedeutung und nicht im Sinne von: (geheimnisvolle) Eingebung, (dunkle) Ahnung.
34. Ein Handeln, in dem ohne Überlegung schnell und sicher das Richtige getan wird, nennt man oft auch instinktiv. Da der Begriff »instinktiv« jedoch mehr die angeborenen und unmittelbar ausgelösten Verhaltensweisen bezeichnet, ziehe ich den Begriff »intuitiv« vor, der auf kognitive Fähigkeiten verweist (vgl. vorhergehende Fußnote).
35. Außerdem, nicht zu vergessen: Eine Reflexion auf die eigene Tätigkeit, für die eine Supervision sehr nützlich sein kann, um auf Phänomene aufmerksam gemacht zu werden, die man übersah, oder um der Gefahr von Selbsttäuschungen vorzubeugen!
36. Deshalb sind die Erziehungswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen nicht automatisch auch gute praktische Pädagogen und Pädagoginnen. Oder schärfer formuliert: Sofern und solange sie auch in der Praxis von ihrer Gewohnheit des diskursiven Denkens nicht ablassen können, bestätigen sie eher das allgemeine (Vor)Urteil über die im praktischen Leben oft umständlich-hilflosen Theoretiker.
37. So manche, die im Studium die abstrakte Theorie kritisierten, bestätigen nach dem Studium, welchen Nutzen sie durch das Studium im Vergleich zu anderen gehabt hätten, die nicht durch die Schule der Wissenschaft gehen konnten ...
38. Wer den Studienort wechselt, erfährt dies meist sehr schnell und oft leidvoll, da ein ordnungsgemäßes Studium an dem einem pädagogischen Institut noch lange nicht garantiert, die an einem anderen Institut geforderten Wissensinhalte erworben zu haben.
39. Mit dem Begriff gesichertes Wissen werden hier Theorien und Erkenntnisse bezeichnet, über deren Richtigkeit es innerhalb (der überwiegenden Mehrheit) der jeweiligen Fachwissenschaftler keinen Streit gibt, die also allgemein als gültig akzeptiert werden.
40. Mit den Begriff alternative Theorien wird hier die Tatsache bezeichnet, daß es zu einem Problem mehrere Theorien gibt, die nicht verschiedene Aspekte beleuchten oder sich komplementär ergänzen, sondern unterschiedliche Erklärungen anbieten, wobei über die Frage der jeweiligen Gültigkeit innerhalb der Fachwissenschaftler kontrovers diskutiert wird.
41. Bereits dieser kurze Vergleich zeigt: Es sind in den verschiedenen Fächern und Berufen zum Teil recht unterschiedliche Fähigkeiten, die verlangt werden, und Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gilt. Die häufig beobachtbare gegenseitige Geringschätzung jedenfalls ist falsch am Platz: Die Naturwissenschaftler, die geisteswissenschaftliche Theorien als Geschwätz ansehen, würden sich wohl in diesen Wissenschaften selbst häufig sehr verloren vorkommen, da bei Streitfragen meist keine empirischen Beweise möglich sind, sondern die Stichhaltigkeit von Argumenten geprüft werden muß; die auf die angeblich geistlosen Naturwissenschaften herabblickenden Geisteswissenschaftler hätten wohl häufig erhebliche Schwierigkeiten, deren formale Strenge im Denken selbst zu vollziehen.
42. Vieles von dem, was hier ausgeführt wird, trifft so oder ähnlich auch zu, wenn den Studierenden nicht (Lehr)Personen gegenüberstehen, sondern sie sich mit wissenschaftlichen Texten befassen.
43. Die Situation im Bereich der ehemaligen DDR nach dem Beitritt zur BRD bietet dafür ein besonders drastisches Beispiel.
Albert, H.: Traktat über kritische Vernunft. Tübingen 1969
Asendorpf, J.: Keiner wie der andere. Wie Persönlichkeitsunterschiede entstehen. München 1988
Benard, Ch.: Alles Gute zum Muttertag. In: S.R. Dunde (Hrsg.): Geschlechterneid - Geschlechterfreundschaft. Frankfurt/M. 1987
Berg Ch.: »Rat geben«. Ein Dilemma pädagogischer Praxis und Wirkungsgeschichte. In: Z.f.Päd. 37 (1991), S. 709-734
Brezinka, W.: Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft. Weinheim und Basel 1972
Brinkmann, W., Renner, K.: Einleitung der Herausgeber oder Über die Schwierigkeit, in die Pädagogik einzuführen. In: Dies. (Hrsg.): Die Pädagogik und ihre Bereiche. Paderborn, München, Wien, Zürich 1982
Broad, W., Wade, M.: Betrug und Täuschung in der Wissenschaft. Basel, Boston, Stuttgart 1984
Bundesarbeitsgemeinschaft der Diplompädagogen e.V. (Hrsg): Diplompädagogen in traditionellen und neuen Arbeitsfeldern. Essen 1986
Derbolav, J.: Grundriß einer Gesamtpädagogik. Hrsg. von B.H. Reifenrath. Frankfurt/M. 1987
Derbolav, J.: Grundlagen der Wissenschaftslogik. In: Pädagogische Rundschau 29 (1975), S. 5 - 62
Duden Fremdwörterbuch. Bearb. vom Wiss. Rat d. Dudenredaktion. 5. Aufl., Mannheim, Wien, Zürich 1990
Fischer, E. P.: Gene sind anders. Erstaunliche Einsichten einer Jahrhundertwissenschaft. Hamburg 1988
Gazzaniga, M.,S.: Das erkenndende Gehirn. Entdeckungen in den Netzwerken des Geistes. Paderborn 1988
Giesecke, H.: Einführung in die Pädagogik. Neuausgabe, Weinheim, München 1990
Gould, S. J.: Der falsch vermessene Mensch. Basel, Boston, Stuttgart 1983
Hegel, G. W. F.: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Erster Teil: Die Wissenschaft der Logik. In: Ders.: Werke in zwanzig Bänden. Theorie Werkausgabe Suhrkamp. Band 8. Frankfurt 1970
Herbart, J. F.: Die ersten Vorlesungen über Pädagogik (1802). In: Ders.: Pädagogische Schriften. Erster Band: Kleinere pädagogische Schriften. Hrsg.v. W. Asmus. Stuttgart 1982
Jaynes, J.: Der Ursprung des Bewußtseins durch den Zusammenbruch der bikameralen Psyche. Hamburg 1988
Lenzen, D. (Hg.): Pädagogische Grundbegriffe, 2. Bde., Reinbeck bei Hamburg 1989
Leonhard, H.-W.: Die Leugnung des Geistes. Eine pädagogische Streitschrift zur empirischen Psychologie. Bad Heilbrunn 1989
Lewontin, R. C., Rose, St., Kamin, L.: Die Gene sind es nicht. München, Weinheim 1988
Litt, Th.: Naturwissenschaft und Menschenbildung. Heidelberg 1959
Litt, Th.: Das Wesen des pädagogischen Denkens. Anhang zu: Litt, Th.: Führen oder Wachsenlassen. Stuttgart 1967
Popper, K. R.: Die Logik der Sozialwissenschaften. In: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Hrsg. v. Th. W. Adorno u.a., Neuwied, Berlin 1969
Popper, K. R.: Logik der Forschung. Tübingen 1971
Quitzow, W.: Intelligenz - Erbe oder Umwelt. Wissenschaftliche und politische Kontroversen seit der Jahrhundertwende. Stuttgart 1990
Schmidt, G.: Drang und Lust. In: H. Kentler (Hrsg.): Sexualwesen Mensch. München 1988
Spaemann, R., Loew, R.: Die Frage Wozu? München 1985